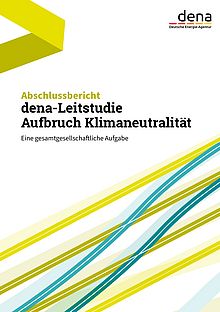
Informationen zum Cyberangriff auf die dena: Zur Meldung.
Klimaneutralität ist eine historische und fundamentale Herausforderung für Wirtschaft, Gesellschaft und Politik. Ein grundlegendes Neudenken und eine vollständige Transformation des Energie- und Wirtschaftssystems sind gefordert.
Die dena-Leitstudie Aufbruch Klimaneutralität identifiziert die entscheidenden Handlungsfelder und Lösungsansätze. Sie bietet eine Basis für fundierte strategische Entscheidungen der politischen und wirtschaftlichen Akteure zur Erreichung von Klimaneutralität 2045.
Deutschland hat sich dazu verpflichtet, die Ziele des Pariser Klimaabkommens zu erreichen und bis zum Jahr 2045 weitgehend treibhausgasneutral zu sein. Dafür sind die 2020er Jahre entscheidend – wir befinden uns in einer Dekade der Weichenstellungen. Doch welche Weichen genau gilt es zu stellen?
Diese Frage beantwortet die dena-Leitstudie Aufbruch Klimaneutralität. Mit einem breiten Stakeholder-Kreis aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Gesellschaft wurden konkrete Lösungssätze und CO2-Reduktionspfade erarbeitet. Über 70 Projektpartner, ein 45-köpfiger Projektbeirat und mehr als 10 renommierte Institute als Gutachter tragen mit Markt- und Fachkenntnis dazu bei, dass die Transformationspfade der dena-Leitstudie ambitioniert und gleichzeitig realistisch sind. Denn die wissenschaftliche Szenario-Bildung und Modellierung wurde mit den Akteuren abgeglichen, die daraus folgende Pfade beschreiten und die Lösungsansätze in der Realität umsetzen müssen. Das macht die Ergebnisse praktikabel und besonders belastbar.
Die dena-Leitstudie Aufbruch Klimaneutralität ist eine Basis für fundierte strategische Entscheidungen der politischen und wirtschaftlichen Akteure zur Erreichung von Klimaneutralität 2045. Die Ergebnisse sollen Wirtschaftsakteuren strategische Orientierung zur Ausrichtung ihrer Geschäftsaktivitäten auf dem Weg in eine klimaneutrale Gesellschaft geben. Der Politik werden konkrete Empfehlungen für die Weichenstellungen in der kommenden Legislaturperiode angeboten. In Ergänzung zu einer umfassenden Analyse nennt die dena-Leitstudie Aufbruch Klimaneutralität insgesamt 84 Aufgaben in zehn zentralen Handlungsfeldern.
Die Transformation zur Klimaneutralität betrifft jeden Lebensbereich und jedes politische Ressort. Diese Querschnittsaufgabe ist jedoch nicht allein mit einer Verteilung auf verschiedene Bundesministerien mit ihrer eigenen Sicht und eigenen politischen Agenda anzugehen. Stattdessen braucht Klimaneutralität eine ganzheitliche politische Betrachtung, in der verschiedene Politikfelder – insbesondere Energie-, Umwelt-/Klima- und Wirtschaftspolitik – integriert und koordiniert werden.
Die Bundesregierung sollte der Erreichung des Ziels Klimaneutralität und der auf dem Weg dorthin gesetzten THG Minderungsziele ebenso hohe Priorität einräumen wie anderen Zielen zur Abwendung unmittelbarer Gefahren für die Gesellschaft. Zur Sicherstellung der Zielerreichung sollte für zentrale Pfade bereits bei der Planung von Maßnahmen und politischen Instrumenten definiert werden, welche Zusatzmaßnahmen im Falle einer zu geringen Minderungsdynamik getroffen werden. Dabei müssen teilweise auch höhere Kosten in Kauf genommen werden, um die Wahrscheinlichkeit der Zielerreichung zu erhöhen.
Die Bundesregierung sollte sich insbesondere nicht zu stark auf einzelne Pfade oder aus heutiger Sicht unsichere Faktoren verlassen. In Ergänzung sollten die Planungen auch alternative bzw. zusätzliche Möglichkeiten zur Zielerreichung vorsehen. Dabei sollten beispielsweise auch die zukünftigen Energiebedarfe für Negativemissionstechnologien in die Ausbaupfade und die geplanten Strombedarfe integriert werden.
Zur Erstellung einer robusten Planung sollte die Bundesregierung zudem explizit auch Modellierungsszenarien auswerten lassen, in denen die nationalen Klimaziele nicht erreicht werden, um hieraus beispielsweise warnende Frühindikatoren abzuleiten.
Die Bundesregierung sollte die wirtschaftspolitischen und unternehmerischen Chancen von Energiewende und Klimaschutz stärker wahrnehmen und fördern. Hierfür wird ein gutes Marktumfeld für klimafreundliche und nachhaltige Geschäftsmodelle und ein Werben für Green-Tech-Produkte aus Deutschland auch international benötigt (siehe Kapitel 2 „Marktdesign“ und Kapitel 3 „Innovation“).
Hierzu sollten im Rahmen einer integrierten Technologie- und Industriestrategie die zur Erreichung der globalen Klimaziele notwendigen Technologien und der derzeitige Entwicklungsstand der deutschen Akteure bzw. die Position auf dem Weltmarkt ermittelt werden, um hieraus Potenziale und Möglichkeiten der konkreten Exportförderung abzuleiten.
Die Bundesregierung sollte klare demokratische Steuerungsmechanismen einrichten bzw. stärken, um damit der querschnittlichen Funktion von Klima-, Energie- und Wirtschaftspolitik gerecht zu werden.
Insbesondere sollte die Bundesregierung als sichtbares Gremium für die Koordination zwischen den betroffenen Bundesressorts das „Klimakabinett“ unter Führung des Bundeskanzleramts gestärkt und die Steuerungsfunktion des Kanzleramts insgesamt organisatorisch ausgebaut und verankert werden. In einem regelmäßigen Bund-Länder-Dialog sollten bundespolitische Konzepte mit denen der Bundesländer abgeglichen werden, um eine konsistente Klimapolitik zu ermöglichen.
Der Bundestag sollte in Fragen von Klimaschutz und Energiepolitik gestärkt werden und koordinierter handeln. Hierzu sollte ein parlamentarischer Ausschuss „Klimawende“ eingerichtet werden. Ergänzend dazu sollte eine übergreifende Enquete-Kommission eingerichtet werden, in der grundlegende Ausrichtungen diskutiert und eine gemeinsam getragene Position als Basis für eine verbesserte Kommunikation erarbeitet werden.
Bundesregierung und Bundestag sollten mit dem Start der neuen Legislaturperiode die kommunikative Begleitung von Energiewende und Klimaschutz deutlich ausbauen, einen gesamtgesellschaftlichen Diskursprozess initiieren und im Rahmen von entsprechenden Ausschüssen im Bundestag stärker an einem gemeinsamen Verständnis für die Pfade zur Erreichung der Klimaziele arbeiten.
Es bedarf einer kohärenten Ausgestaltung des Gesamtrahmens für das Energiesystem – während und nach der Transformation. Darunter sind die Marktregeln und Regulierungsvorschriften zu verstehen, die die Energieversorgung langfristig in effizienter und sicherer Weise gewährleisten. Dazu gehören aber auch Maßnahmen, die kurz- und mittelfristig die Transformation und Marktveränderung im Energie- und in den Verbrauchssektoren einleiten und sich politisch in ausreichendem Maß steuern lassen.
Die EU sollte bei der CO2-Bepreisung mittelfristig anstreben, die heute im nationalen BEHG abgedeckten Sektoren, v.a. die betroffenen Verkehrssektoren (Individualverkehr, Schifffahrt, Schwertransport) in ein einheitliches europäisches Handelssystem zu überführen. Mittelfristig sollte geprüft werden, ob dieses neu geschaffene Emissionshandelssystem mit dem bereits bestehenden EU-ETS verschmolzen werden kann.
Für ein europäisches BEHG sind Reduktionsvereinbarungen sowie eine Lastenteilung (Effort Sharing) mit den Mitglied- staaten auszuhandeln, die sich einerseits an den entspre- chenden sektoralen Zielen der NECP und andererseits an den beobachteten Wirtschaftsaktivitäten der BEHG-Sektoren ausrichten sollte.
Die Bundesregierung sollte anstreben, die Abgaben auf Energie – soweit finanzierbar und EU-rechtlich zulässig – auf die CO2-Bepreisung und Infrastrukturabgaben zu fokussieren, um die Effizienz der CO2-Bepreisung zu erhöhen und Verzerrungen zwischen den Energieträgern zu beseitigen, wie es auch der Vorschlag der Kommission für die neue Energie- steuer-Richtlinie vorsieht.
Dazu sollte in einem ersten Schritt die EEG-Umlage auf null abgesenkt werden.
Im Zug einer möglichen Absenkung der Energiesteuer (früher Mineralölsteuer) muss gegebenenfalls die Einführung einer Infrastrukturabgabe für den Straßenbau in Erwägung gezo- gen werden.
Die Bundesregierung sollte eine ganzheitliche Finanzierungsplanung für die Energiewende entwickeln.
Grundlage hierfür bildet eine genaue Bewertung der laufenden und perspektivisch erwartbaren Einnahmen und Ausgaben im Kontext der Energiewende auf Basis der bestehenden Rahmenbedingungen. Diese Bewertung sollte dann ergänzt werden um die in verschiedenen Studien zur Erreichung der Klimaneutralität aufgezeigten Transformationserfordernisse und die hierbei bezifferten erforderlichen Investitionen. Darüber hinaus sollte eine Analyse der zur Zielerreichung zusätzlich nötigen Finanzierungserfordernisse erfolgen – sowohl über die verschiedenen politischen Handlungsebenen (Bund, Land, Kommunen) und Stakeholder (öffentliche Institutionen, Unternehmen, private Verbraucher) sowie in Abwägung des gewählten Instrumentenmix aus Marktaktivierung, Ordnungsrecht, staatlichen Förderinstrumenten und marktlichen Rahmensetzungen wie beispielsweise Quotensysteme.
Im Ergebnis soll ein über die Zeit tragfähiges Konzept zur Finanzierung der für die Energiewende erforderlichen und durch staatliche Fördermechanismen und Instrumente angereizten Investitionen sowie notwendiger flankierender Maßnahmen entstehen.
Zur zukünftigen Planung von Energieinfrastrukturen sollte die Bundesregierung die Einführung eines neuen, partizipativen Prozesses zur Erarbeitung eines Systementwicklungsplans auf gesetzlicher Basis auf den Weg bringen.Vorschläge zur genauen Ausgestaltung können den Ausarbeitungen der dena-Netzstudie III entnommen werden. Wichtige Elemente des Prozesses sind:
Die in einigen Bundesländern bereits eingeführte und auf Bundesebene befürwortete verbindliche kommunale Wärmeplanung nach dem Vorbild Dänemarks stellt einen wichtigen Schritt zur Defossilisierung des Wärmesektors dar.
Die Bundesregierung und die Landesregierungen sollten darüber hinaus die kommunale Wärmeplanung zu einer mit der Netzausbauplanung abgestimmten, integrierten Energieleitplanung weiterentwickeln, um einen sektorübergreifenden Abgleich der strategischen Ausrichtung und der Planungsprozesse zu etablieren. Es ist dabei zu prüfen, auf welcher Verwaltungsebene (Gemeinde, Stadt, Landkreis, Bezirk) die Planung sinnvoll angesiedelt werden sollte. Wichtig ist, durch eine geeignete Governance-Struktur die Unabhängigkeit des zuständigen Gremiums z.B. in den Kommunen mit Blick auf kommunale Beteiligungen und Betriebe sicherzustellen. Die kommunale Energieleitplanung kann sich dabei an den Grundprinzipien des Systementwicklungsplans orientieren, das heißt, sie ergänzt die sektorale Planung durch eine übergeordnete und ganzheitliche Gesamtstrategie und schafft Synergien. Gleichzeitig kann sie durch die Erhebung detaillierter lokaler Daten die überregionale integrierte Infrastruk- turplanung unterstützen.
Die Bundesregierung sollte die Bundesnetzagentur auffordern, Vorschläge zur Weiterentwicklung der Kostenregulierung von Energieinfrastrukturen vorzulegen, um auch eine effektive Optimierung über Sektor- oder Infrastrukturgrenzen hinweg zu erreichen, beispielsweise durch Outputorientierte Regulierungselemente sowie eine Reform der Netzentgelte und -anschlussgebühren mit Blick auf Anreize für eine sektorübergreifende Netzdienlichkeit von Investitionen und Fahrweisen.
Die Innovationsgeschwindigkeit in den Bereichen Energie, Mobilität, Materialforschung, Digitalisierung und selbst Lebensmittel ist immens. Die Diskussion um den Beitrag von Innovationen zur Erreichung der Klimaneutralität verläuft schwerfällig. Es bedarf sofortigen Handelns und eines klaren Blicks für das zu hebende Innovationspotenzial. Ein Ignorieren dieser teils disruptiven Entwicklungen schränkt die Optionen für die Pfade zur Zielerreichung unnötigerweise ein und schadet damit am Ende dem Klimaschutz.
Der Staat sollte als aktiver Change-Agent Innovationen anstoßen und ermöglichen. Durch das Zusammenbringen und Miteinbeziehen von treibenden Innovationsakteuren in den unterschiedlichen Sektoren sollte ein aktives Chancen-Management ermöglicht werden, indem Chancen erkannt und die Eintrittswahrscheinlichkeit durch entsprechende Maßnahmen erhöht wird. Innovationsakteure sollten als Treiber, Gestalter und Umsetzer von innovativen Technologien, Prozessen und Konzepten agieren. Durch die Vernetzung von Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft sollte ein Umfeld geschaffen werden, in dem Ideen entwickelt sowie der Markteintritt und die Skalierbarkeit ermöglicht werden. Start-ups können dabei von der Expertise etablierter Unternehmen profitieren und die Unternehmen von Start-Ups Anpassungsfähigkeit und Adaptionsgeschwindigkeit lernen.
Für die Politik als Innovationstreiber und Innovations-Portfoliomanager sollten auch Misserfolge und Experimente Teil des Innovationsprozesses sein und aktives Lernen aus Fehlern und Experimenten ermöglicht werden. Ein innovationsfreundliches Umfeld benötigt neben einer positiven
Fehlerkultur auch transparente Kommunikation, Technologieoffenheit, Zugang zu Wissen, Freiraum für Ideen und die Bereitstellung der nötigen Ressourcen. Ziel muss sein, „Klimaneutralität Made in Germany“ zu etablieren und Deutschland als Industrie- und Technologienation zu stärken.
Die Innovationspolitik sollte nicht nur die Förderung der Entwicklung von Ideen auf der Angebotsseite enthalten, sondern ebenfalls eine Stärkung der Nachfrageseite. Denn für einen erfolgreichen Markthochlauf und eine langfristige Etablierung muss eine dem Angebot entsprechende Nachfrage gesichert werden. Zum einen kann die Nachfrage durch den Erwerb und die Nutzung der Innovationen durch die öffentliche Hand gesteuert werden (Green Procurement). Hier kann beispielsweise die Einführung eines Schattenpreises pro Tonne CO2 die entsprechende Lenkungswirkung haben. Zum anderen kann die private Nachfrage unmittelbar durch Subventionen oder Steuervorteile und mittelbar ebenfalls durch die Schaffung von Nachfragekompetenz (das heißt, Nutzerinnen und Nutzer wissen, wie die Innovation angewendet wird, usw.) gefördert werden. Darüber hinaus können die Einführung von Normen und Regulierungen, grüner Leitmärke, Quoten, Zertifikate oder ein starker CO2-Preis eine zusätzliche Lenkungswirkung hin zu nachhaltigen und grünen Innovationen haben.
Der Staat als Treiber und Möglichmacher von Innovationen ist nicht nur die Bundesebene. Viele Innovationen betreffen andere Verwaltungsebenen, so beispielsweise das Upgrade der Radwege, das von den Städten und Kommunen umgesetzt werden muss. Für die Umsetzung benötigen die Städte und Kommunen außerdem finanzielle Unterstützung und den nötigen Spielraum in der Stadtplanung, beispielsweise bei der Anpassung des Straßenverkehrs.
Da die einzelnen Regionen teilweise vor ganz individuellen Herausforderungen stehen, ist eine dezentrale Förderung sinnvoll. Dabei sollten Bundescluster und regionale Cluster dennoch koordiniert werden. Für die Koordination einer erfolgreichen, bundesweiten Umsetzung müssen die Zustän- digkeiten optimiert werden. Eine klare Kommunikation und Informationsaustausch ist zum einen zwischen den unter- schiedlichen Verwaltungsebenen notwendig. Darüber hinaus ist auch die Kommunikation innerhalb der Ebenen wichtig, da der Austausch von Best-Practice-Beispielen und Erfahrungen dazu beitragen kann, Projekte erfolgreich umzusetzen. Auch Leitfäden können den Ländern, Städten und Kommunen als Hilfestellung bei der Umsetzung dienen. Für die sogenannten Pop-up-Radwege in Berlin hat der Berliner Senat beispielsweise einen Regelplan zur Identifizierung geeigneter Straßen erarbeitet und ergänzend erfolgreich umgesetzten Projekte in einem Onlineportal gesammelt.
In der EU gibt es bereits verschiedene Rahmen- und Förderungsprogramme, die neben der finanziellen Unterstützung auch sicherstellen sollen, dass es innovative Ideen langfristig in den Markt schaffen. Dies soll vor allem durch die Intensivierung der internationalen Zusammenarbeit und durch den Aufbau von Partnerschaften zwischen der Industrie und der öffentlichen Hand geschehen. Ein Aufbau solcher Partnerschaften ist nicht nur für Ideen, die auf EU-Ebene gefördert werden, sinnvoll, sondern ebenfalls für Innovationen, die von der Ebene der Nationalstaaten kommen. Daher bedarf es einer Vernetzung über diese Ebenen hinaus. Die Kommunikation solcher Programme muss in die Mitgliedstaaten hinein erfolgen, damit die entsprechenden Akteure wirklich von der Vernetzung profitieren können.
Der Staat soll die Rahmenbedingungen für ein innovationsfreundliches Umfeld schaffen. Die Aufgabe von privaten Akteuren ist es, dieses Umfeld zu nutzen und im Wettbewerb die besten Ideen zu entwickeln. Dieses innovationsfreundliche Umfeld soll nicht nur zur Neugründung genutzt, sondern ebenfalls von etablierten Unternehmen stärker wahrgenommen werden. Vor allem die Unternehmen, die in den Schlüsselbranchen der Energiewende tätig sein, so beispielsweise im Bereich Energieversorgung oder Bauwirtschaft, müssen Erneuerungen und Nachhaltigkeit als Teil des zukünftigen Geschäftsmodels verstehen und mehr auf Forschung und Entwicklung setzen. Neben der eigenen Forschung und Entwicklung von Ideen ist auch die Förderung von Start-Ups sinnvoll.
Der Weg zur Klimaneutralität ist in der Gesamtheit der dafür erforderlichen sozioökonomischen Veränderungen einer der größten Transformationsprozesse in der Geschichte der Menschheit. Auch für die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland werden die notwendigen Veränderungen in jedem Lebensbereich spürbar. Neben den technischen Herausforderungen müssen daher auch ökonomische, kulturelle und strukturelle Faktoren dieses gesamtgesellschaftlichen Wandels sowie soziale Herausforderungen berücksichtigt werden.
Die Bundesregierung sollte Ausgleichmechanismen schaf- fen, um die Kosten der Energiewende sozial gerecht zu verteilen und einkommensschwache Haushalte zu entlasten. Die Absenkung der EEG-Umlage auf null würde dabei zu den Zielen der Reform von Steuern und Abgaben beitragen (siehe Kapitel 2 „Marktdesign“) und zudem eine verteilungspolitische Wirkung entfalten.
Zusätzlich sollten Konzepte zur ProKopfRückvergütung geprüft werden, die die Preissteigerungen infolge der CO2- Bepreisung für die Bürgerinnen und Bürger abfedern und dabei besonders einkommensschwachen Haushalten zugute kommen. Gezielte Hilfen für Geringverdiener und die beson- ders von den Maßnahmen betroffenen Personen ergänzen die Betrachtung der sozialen Gerechtigkeit.
Auch auf europäischer Ebene sollte die Bundesregierung die Instrumente für einen sozialen Ausgleich stärken. So sollte sie sich etwa für eine Durchsetzung und ausreichende Finanzie- rung des vorgeschlagenen Klimasozialfonds einsetzen und für die Aufstockung des Modernisierungsfonds werben, um die zusätzlichen Kostenbelastungen durch die neuen Preissignale in den Sektoren Verkehr und Gebäude abzufedern.
Die Bundesregierung sollte klimaschädliche Subventionen abschaffen und die resultierenden Zusatzeinnahmen für Klimaschutzprojekte und den Ausgleich sozialer Härtefälle verwenden. Daneben sind sämtliche staatlichen Förderungen und Anreizsysteme auf ihre Klimawirkung zu überprüfen.
Die Bundesregierung sollte bessere Rahmenbedingungen für eine Partizipation an der Energiewende schaffen. Sie sollte dabei prüfen, wie Zahlungen von Anlagenbetreibern an die Standortkommunen größere Freiheiten eingeräumt werden können. Dabei sollte durch eine Anpassung des § 6 EEG 2021 die Möglichkeit der finanziellen Beteiligung von Standortgemeinden von der Freiwilligkeit in die Verbindlichkeit überführt werden. Hierdurch wird Einheitlichkeit geschaffen und Vertrauen gefördert. Den Standortgemeinden wird die Verwendung dieser Zahlungen für die Entwicklung und Umsetzung lokaler Projekte, vor allem mit besonderem Bezug zum Klimaschutz oder zur Klimaanpassung empfohlen, beispielsweise Sanierungsprogramme, der Aufbau von E-Ladesäulen oder zusätzliche Begrünungen. Hierdurch und durch weitere Möglichkeiten wie dem Angebot erneuerbarer regionaler Bürgerstromtarife werden die Vorteile der Energiewende für die Bürgerinnen und Bürger unmittelbarer erfahrbar.
Die Bundesregierung sollte Beteiligungsformate auf allen Ebenen als Chance betrachten, um eine Wertepluralität sowie verschiedene regionale Wissens- und Kenntnisstände in den Planungsprozess einzubeziehen und Legitimität für die jeweiligen Ergebnisse zu schaffen, dabei gleichzeitig aber vor allem die Qualität der Ergebnisse zu erhöhen.
Die Bundesregierung sollte in Planungsprozessen auf das Beteiligungsparadoxon (das heißt Beteiligungswille steigt erst in spätem Stadium der Planung, wenn kaum Gestaltungsmöglichkeiten bestehen) eingehen und schon in einem frühen Stadium der Planung offensiv für eine Beteiligung werben und Möglichkeiten zum Austausch schaffen. Beteili- gungsprozesse müssen so gestaltet werden, dass sie insgesamt für eine erhebliche Beschleunigung der Planungen sorgen und sie nicht dauerhaft verlangsamen.
Die Bundesregierung, die Länder und die Kommunen sollten die Expertise der Bürgerinnen und Bürger vor Ort nutzen, um die bestmögliche lokale Strategie zu entwickeln, Flächen zu nutzen und auf regionale Besonderheiten einzugehen. Durch eine bottom-up entwickelte Planung von Energievorhaben wird ihre Umsetzung wesentlich erleichtert.
Die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an der Energiewende muss vereinfacht werden. Die Bundesregierung sollte daher prüfen, ob für Bürgerenergiegesellschaften Ausschreibungen mit separaten Kontingenten und administrativ festgesetzten Fördersätzen eingesetzt werden können.
Außerdem sollte die Bundesregierung insbesondere Artikel 21 RED II (EU-Erneuerbare-Energien-Richtlinie) umsetzen, sodass ein funktionierender Rahmen für Energy Sharing bzw. die gemeinschaftliche Eigenversorgung innerhalb von Renewable Energy Communities in Deutschland geschaffen wird. Darüber hinaus gilt es, die regulatorischen Rahmenbedingungen für PV-Mieterstromprojekte weiter zu verbessern und die und marktlichen Hürden für Prosumer zu beseitigen.
Die Bundesregierung sollte ein Projekt zur Verbesserung der „User Experience“ durchführen und das persönliche Erleben von Energiewende und Klimaschutz durch vereinfachte administrative Prozesse erhöhen, indem beispielsweise der Zugang zu Fördermitteln erleichtert wird.
Die Bundespolitik, die Landespolitik, Unternehmen, NGOs, Verbände und lokale Akteure müssen das Narrativ der Energiewende zu einem positiven Narrativ machen. Dabei dürfen Herausforderungen und Probleme nicht verschwiegen, alternative Optionen zur Zielerreichung nicht diskreditiert werden. Die Energiewende muss (wieder) zu einer Erfolgsgeschichte werden und darf nicht hauptsächlich als teure Unternehmung, die über die Köpfe der Bevölkerung hinweg entschieden wird, wahrgenommen werden. Klimaschutz darf nicht als Serie von Verzichten und Verboten wahrgenommen werden. Ein gesellschaftlicher Konsens, basierend auf einer breiten Kenntnis der damit verbundenen Aufgaben (siehe Kapitel 1 „Gesamtstrategie“), ist hierfür Grundvoraussetzung.
Die Bundesregierung und alle Akteure der Energiewende sollten die im Rahmen der Energiewende entstehenden Investitionsbedarfe offen darstellen. So kann transparent und nachvollziehbar kommuniziert werden, welche Belastungen, Änderungen und auch finanziellen Aufwände mit der Energiewende und dem Klimaschutz einhergehen, aber auch, wie diese bestmöglich abgefedert oder zu positiven ökonomischen Szenarien mit positiven Effekten wie verringerter Luftverschmutzung, Heizkosten und Lärm entwickelt werden können. Genauso wichtig wird es sein, Folgekosten des Nichthandelns nüchtern und auf konkreten Abschätzungen beruhend zu kommunizieren.
Die Bundesregierung sollte Informationsangebote zu Klimaschutz und Energiewende weiter ausbauen, gezielt bewerben und möglichst ressortübergreifend organisieren. Dieses Vorgehen bietet die Chance, eine Vielzahl von Kommunikationsmaßnahmen und Aktivitäten unterschiedlicher Akteure in einer kommunikativen Klammer zu bündeln und als ein gemeinsames „Anpacken“ darzustellen. Dabei sollten Fakten vermittelt werden, auf deren Grundlage die Bürgerinnen und Bürger auch komplexe Zusammenhänge verstehen und eigene Handlungsoptionen erkennen. An der Schwelle zum aktiven Handeln sollten zudem positive Beispiele des Gelingens, die das Vertrauen in die Leistungsfähigkeit unserer Gesellschaft und Wirtschaft stärken, mit digitalen oder loka- len Beratungs- und Unterstützungsangeboten kombiniert
werden.
Forschungsprojekte im Rahmen der Transformation zur Klimaneutralität sollten darüber hinaus auch zur Wissensbildung gesellschaftlicher Zusammenhänge beitragen, indem Projekte vermehrt gesellschaftsrelevante Begleitforschung auch bei technologischen Themen enthalten.
Zur Verbesserung des Informationsangebots sollte bei einer Institution der Bundesregierung eine „Geschäftsstelle Szenarios & Analysen für Energiewende und Klimaneutralität“ eingerichtet werden, durch die, unterstützt durch entsprechende Dialogformate, eine laufende Analyse und Aufbereitung der Vielzahl vorgelegter Studien und Berichte vorgenommen wird.
Es sollte ein kontinuierliches Kompetenz-Monitoring ausgebaut werden und damit ausreichende und passende Weiterbildungsangebote geschaffen werden. Über eine fundierte Abschätzung des Bedarfs an hochqualifizierten Fachkräften für Zukunftsbranchen (etwa in Abstimmung mit den Industrieverbänden) sollte die Bundesregierung bei abzusehendem Fachkräftemangel Maßnahmen in die Wege leiten und Anreize schaffen, um ausreichend Kapazitäten, beispielsweise in der Lehre aufzubauen.
In Ausbildungsprogrammen sollten vermehrt Klimaschutz-relevante Technologien und Inhalte berücksichtigt werden. Auch die Zuwanderungspolitik sollte den Fachkräftebedarf berücksichtigen.
Zudem sollte die Bundesregierung dazu beitragen, dass Anreize für verstärkte Investitionen in Aus- und Weiterbildungsprogramme im Handwerk erhöht werden.
Kommunen müssen dazu befähigt werden, zu Multiplikatoren der Energiewende zu werden. Diese Rolle der Kommunen sollte gestärkt und auch mit zusätzlichen Bundesmitteln gefördert werden. Durch Finanzmittel werden Kommunen besser in die Lage versetzt, die Energiewende bottom-up voranzutreiben und die bestmöglichen Ansätze zu finden und umzusetzen.
Der Bund sollte die Investitionstätigkeiten der Städte und Kommunen beispielsweise über eine Erhöhung der Regionalisierungsmittel noch stärker unterstützen. Besondere Bedeutung für den Klimaschutz in Kommunen haben die auf der Kommunalrichtlinie im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative aufbauenden Förderprogramme.
Die Kompetenzen und der rechtliche Rahmen von Kommu- nen müssen es ihnen ermöglichen, etwa in der Verkehrsplanung Flächen neu zu ordnen und zu einer Mobilitätswende beizutragen. Die Digitalisierung als Treiber neuer Verkehrskonzepte und eines reduzierten Verkehrsaufkommens sollte in den Städten und Kommunen deutlich beschleunigt werden (siehe auch Exkurs „Digitalisierung der Energiewende“).
Der Einsatz von Klimaschutzmanagerinnen und -managern ist für Kommunen unbezahlbar. Die Bundesregierung sollte über eine Stärkung der Fördertöpfe und eine Vereinfachung der Anträge dazu beitragen, dass alle interessierten Kommunen Unterstützung des Bundes für Personalstellen für kommunales Nachhaltigkeitsmanagement erhalten.
Die in Kapitel 2 „Marktdesign“ dargestellte kommunale Energieleitplanung als Ergänzung zur überregionalen Planung ist eine Möglichkeit zur weiteren Stärkung der Rolle von Kommunen und ergänzt eine verpflichtende kommunale Wärmeplanung, die von Bund und Ländern unterstützt werden muss.
Für die Klimafolgenanpassung muss ein rechtlich abgesichertes Finanzierungsprogramm entwickelt werden. Förderprogramme für Klimafolgenanpassung sollten gestärkt und besser auf finanzschwache Kommunen ausgerichtet werden.
Deutschland ist eng in die internationalen Märkte eingebunden und kann besonders von einer europäischen und einer globalen Energiewende profitieren. Innerhalb Europas nehmen der Aufbau und das marktliche Zusammenwachsen sowie die physische Vernetzung von europäischen Märkten für Energie und Güter weiter zu. So ist die Energiewende in Deutschland durch den europäischen Binnenmarkt für Energie eng verknüpft mit Vorgängen auf EU-Ebene und in anderen Mitgliedsstaaten. Hier ist Koordination notwendig.
Deutschland hat eine gewichtige Rolle in der EU und sollte diese für die ambitionierte Umsetzung des Green Deals in der EU aber auch darüber hinaus nutzen. Die Bundesregierung sollte daher den Green Deal proaktiv unterstützen und das „Fit for 55“-Paket sowie andere EU-Aktivitäten rund um Energiewende und Klimaschutz aktiv vorantreiben und zur Leitorientierung auch der nationalen Energie- und Klimapolitik machen. Auf europäischer Ebene sollte sich Deutschland dafür einsetzen, einen praktikablen marktwirtschaftlich orientierten Rahmen und eine dazu konsistente Regulierung zu schaffen. Um Marktverzerrungen im EU-Binnenmarkt zu vermeiden, sollte die Bundesregierung beispielsweise dafür werben, alle industriellen Emissionen in den EU-ETS zu integrieren. Bei allen Maßnahmen müssen alle drei Ziele (Ökologie, Ökonomie und Gesellschaft) mitgedacht werden.
Wichtig ist auch, dass die Bundesregierung in allen Verhand- lungen auf EU-Ebene die Prämisse der EU-Kommission stützt, dass einzelne Elemente des „Fit for 55“-Pakets nur dann von einzelnen Mitgliedsstaaten herausgehandelt werden dürfen, wenn dafür ein Ersatzvorschlag angeboten wird, der die THG- Emissionen im selben Maße senken würde.
Die EU sollte ihre Vorreiterrolle in der globalen Klimadiplo- matie intensivieren, engagiert voranschreiten und die Ziele des Green Deal gut in eine globale Verhandlungsstruktur einbinden.
Längerfristig sollte sich die EU für einen globalen CO2- (Mindest-)Preis bzw. ein globales ETS einsetzen. Dies könnte zunächst auf Basis bilateraler oder multilateraler Abkommen zwischen Vorreiterstaaten entstehen. Der jüngst von der Bundesregierung vorgeschlagene Klimaclub kann dabei zu einer sehr hilfreichen Initiative werden und sollte zu einer europäischen Initiative erhoben und von der EU als Treiber weiterverfolgt werden (insbesondere sollte sich um die Mitgliedschaft wichtiger EU-Handelspartner wie China und den USA bemüht werden).
Die Bundesregierung sollte die Prüfung und Einführung eines geeigneten und WTO-kompatiblen CBAM auf EU-Ebene als zentrales Instrument zum Carbon Leakage-Schutz unterstützen. Da gerade die weitere Ausgestaltung und Umsetzung des CBAM ein hohes Maß an diplomatischem Geschick erfordern wird, sollte die Bundesregierung sich um eine Einbettung des CBAM in den Klimaclub bemühen. Ein Alleingang der EU würde ohne handelspolitische Verständigung unmittelbar zu Konflikten führen und auch Versuche seitens der Handelspartner, den CBAM zu umgehen, sind nicht ausgeschlossen.
Deutschlands Beitrag in einem solchen Klimaclub sollte außerdem darin bestehen, auf globaler Ebene auf einen Markt für klimaneutrale Produkte hinzuwirken, den Ausbau von erneuerbaren Energie zu forcieren und eine globale Wasserstoffwirtschaft zu etablieren. Deutschland sollte hier eine unterstützende Vorreiterrolle einnehmen.
Die Beschleunigung der Energiewende erfordert eine ver- stärkte Kooperation zwischen den Mitgliedsstaaten und auf der Ebene des Europäischen Rates. Dies gilt vor allem bei dem Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft einschließlich der notwendigen europäischen Produktionskapazitäten und Infrastrukturen, dem koordinierten Ausbau der Offshore- Windenergie in Nord- und Ostsee, dem Ausbau der Stromnetze unter Berücksichtigung der neuen Klimaziele sowie der gemeinschaftlichen Gewährleistung der Versorgungs- sicherheit im Stromsektor sowie perspektivisch auch bei Wasserstoff und seinen Derivaten.
Die Bundesregierung sollte sich auf EU-Ebene dafür einset- zen, den regulatorischen Rahmen für eine integrierte Weiterentwicklung der europäischen Energieinfrastrukturen zu verbessern.
Hierzu sollte die Stakeholder-Konsultation zum Nationalen Energie- und Klimaplan (NECP) intensiviert werden und insbesondere mit den Nachbarländern strategische Partnerschaften eingegangen werden. Zudem sollten gemeinsame Aktivitäten mit anderen EU-Staaten zur Umsetzung der „Green Recovery“-Wiederaufbaupläne nach der Corona-Pandemie angestrebt werden. Die nationalen Energieagenturen können hierbei den Austausch von Lernerfahrungen in Bezug auf eine erfolgreiche Umsetzung sowie die Initiierung und Umsetzung gemeinsamer Vorhaben durchführen bzw. steuern.
Auch die stärkere Förderung grenzüberschreitender Projekte ist zu empfehlen, zum Beispiel für Interkonnektoren nicht nur auf Ebene der Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB), son- dern auch auf lokaler Ebene, um ein Zusammenwachsen der Grenzregionen, in denen Europa Teil des Alltags ist, zu befördern. Diese Verbindungen sollten sich nicht nur auf Strom, sondern auch auf Wärme beziehen.
Zum Aufbau von Importmöglichkeiten aus dem Nicht-EU-Ausland sollten die Bundesregierung und die EU die Zahl der Kooperationsabkommen mit geeigneten Partnerländern über die langfristige Abnahme von Wasserstoff bzw. seinen Derivaten weiter aktiv ausbauen. Zudem müssen im Austausch mit globalen Partnern regulatorische Standards für die Produktion von Powerfuels definiert werden, die die reale Klimawirksamkeit in den Herkunftsländern abbilden, aber auch die globale Anwendbarkeit gewährleisten. Sie müssen zusammen mit einem Zertifizierungssystem die Grundlage für den Handel bilden.
Der Gebäudesektor bleibt aktuell hinter der Zielmarke zurück. Zur Erreichung der Klimaziele sind tiefgreifende Veränderungen mit hoher Geschwindigkeit notwendig. Mit Blick auf Energieverbräuche und den Anteil am CO2-Ausstoß ist die Dekarbonisierung des Gebäudesektors von entscheidender Bedeutung für die Erreichung der Klimaziele. Der Gebäudesektor rückte daher im Laufe der letzten Jahre als zentraler Bestandteil im Rahmen des Gesamtsystems immer stärker in den Fokus der Debatten.
Förderprogramme auf das Ziel Klimaneutralität ausrichten
Die Fördersystematik orientiert sich derzeit noch nicht ausreichend an dem Ziel der Klimaneutralität und sollte zukünftig stärker an der Wirksamkeit bezüglich der THG-Reduzierung ausgerichtet werden. Die Zielkonformität sollte eine zentrale Maßgabe sein, um bestehende Förderprogramme zu evaluieren und gegebenenfalls nachzubessern sowie neue Förderprogramme aufzusetzen („Klimaneutralitäts-ready“). Dies bedeutet auch, die Wohnraum- und Städtebauförderung an zielverträgliche Energiestandards anzupassen.
Förderimpulse sollten Technologien und Maßnahmen berücksichtigen, die zur Zielerreichung beitragen und eine breitere Marktdurchdringung unterstützen. Hierzu zählen etwa die Sanierung der Gebäudehülle und der Einsatz effizienter Heizsysteme mit erneuerbaren Energien bzw. THG-neutralen Brennstoffen (dezentral oder über leitungsgebundene Wärmeversorgung). Für die Versorgung mit erneuerbaren Energien ist Energieeffizienz zentral, diese Zusammenhänge sollten daher auch in der Förderpolitik berücksichtigt werden. Denkbar wäre hierbei ein Förderbonus für bestimmte Maßnahmenpakete, die gemeinsam bzw. aufbauend aufeinander umgesetzt werden. Beispielsweise könnte auch die kombinierte Installation von PV-Anlagen und die gleichzeitige Sanierung des Daches gefördert werden, um so doppelte Effekte zu erzielen Hierfür wären zusätzliche Rahmenbedingungen für die Förderung und Qualitätssicherung erforderlich.
Insgesamt müssen aber auch einzelne geförderte Maßnahmen so ineinandergreifen, dass sie insgesamt zielkonform sind. Dies könnte durch begleitende individuelle Sanierungsfahrpläne (iSFP) sichergestellt werden. Im Rahmen der Machbarkeit für Eigentümerinnen und Eigentümer sollten die Maßnahmen auch sukzessive in Schritt-für-Schritt-Sanierungen umsetzbar sein.
Voraussetzung für eine auf Klimaneutralität ausgerichtete Fördersystematik ist eine konsistente Definition, wann Gebäude als klimaneutral eingestuft werden können. Diese Aufgabe sollte die Politik in Abstimmung mit Stakeholdern aus Wissenschaft, Zivilgesellschaft und Wirtschaft so schnell wie möglich angehen.
Prinzip „Fördern&Fordern“ ermöglichen
Aktuell gilt, dass gesetzliche Standards im Gebäudebereich nicht zusätzlich gefördert werden können. Diese Entkopplung von Förderung und Ordnungsrecht sollte reflektiert werden. Denn für die weitgehende Transformation zur Erreichung der Klimaziele sind seitens der Eigentümerinnen und Eigentümer häufig große Investitionen notwendig, vor allem auch im Falle einer Verschärfung der ordnungsrechtlichen Anforderungen in Neubau und Sanierung. Aufgrund der diversen Eigentümergruppen im Gebäudesektor und der unterschiedlichen Ausstattung mit finanziellen Ressourcen sollten ausgewählte ordnungsrechtlich geforderte Maßnahmen auch angemessen finanziell unterstützt werden können, insofern diese ohne Förderung nicht wirtschaftlich umsetzbar sind. Dies kann der Akzeptanz für den Transformationsprozess im Gebäudesektor dienen.
Bestehende effektive Förderung sichern und verstetigen
Bestehende Förderprogramme, die effektiv auf die Erreichung der Klimaziele einzahlen, sollten im Bundeshaushalt nachhaltig gesichert und verstetigt werden. Seit der Aufstockung der Förderprogramme von KfW und BAFA in 2020 ist eine steigende Anzahl von Förderanträgen zu verzeichnen. Die Effektivität der neu strukturierten und in der BEG zusammengefassten KfW- und BAFA-Förderprogramme sollte somit weiterhin genutzt und die Mittel für die Förderung sollten langfristig verstetigt werden.
Wichtig ist eine enge Verzahnung und Abstimmung von Förderprogrammen, sodass es nicht zu einer vermeidbaren Überbelastung der staatlichen Haushalte kommt. Entscheidendes Kriterium hierbei ist neben der Effektivität die Effizienz der Förderung, die fortan regelmäßig überprüft werden sollte. Gleichzeitig sollte die Finanzierung langfristig gesichert werden, um für investierende Privatpersonen sowie Unternehmen Planungs- und Investitionssicherheit zu gewährleisten.
Weiterentwicklung der Förderung für alle Gebäudesektoren (Wohn/Nichtwohngebäude): Heterogenität des Gebäudesektors berücksichtigen
Die Förderung sollte neben den Wohngebäuden auch in weiteren Gebäudesegmenten wie den Nichtwohngebäuden oder Gewerbeimmobilien stärker zum Tragen kommen. Hier besteht Optimierungsbedarf mit Blick auf die Sanierungszahl und -tiefe. Auch die Definition des Referenzgebäudes gemäß GEG sollte überprüft und an den aktuellen Stand der Baupraxis und Technik angepasst werden. Dabei sollte das energetische Niveau des Referenzgebäudes hinsichtlich der Klimaziele ambitioniert ausgerichtet werden und besonders auch im Hinblick auf die Planenden umsetzbar und verständlich formuliert sein.
Mit Blick auf die Einführung der BEG für Nichtwohngebäude wird es erforderlich sein, die Wirksamkeit der Förderprogramme eng zu monitoren und gegebenenfalls anzupassen.
Die Weiterentwicklung der steuerlichen Förderung, zum Bei- spiel durch Verbesserung der Abschreibung für Abnutzung (AfA), und die Ausweitung der steuerlichen Förderung über selbstgenutzten Wohnraum hinaus auf alle Gebäudeklassen sind zentrale Hebel, um die Investitionen für die energetische Gebäudemodernisierung anzureizen. Wirkungsvoll wäre eine Erhöhung der AfA bei gleichzeitiger Verkürzung des Abzugszeitraums.
Als weitere Orientierung der Förderung könnte auf die eingesparte Energie bzw. die CO2-Emissionen abgestellt werden, als Anreiz für mehr Sanierungstiefe: Je mehr eingespart wird, desto mehr wird gefördert.
Das Gebäude wird immer stärker zum Energieerzeuger, zum Beispiel über den Einsatz von KWK-Anlagen und Brennstoffzellen oder PV-Anlagen auf dem Dach oder an der Fassade. Die Erzeugung am und im Gebäude sollte stärker systemisch betrachtet werden. Auf diese Weise können die Eigenstromversorgung sowie die Netzdienlichkeit der Gebäude am effizientesten organisiert werden. Hierfür braucht es einen Abbau regulatorischer Hürden sowie geeignete förderpolitische Anreize.
Bauwerkintegrierte Photovoltaik ist integraler Bestandteil der Gebäudehülle und sollte damit im Zusammenspiel mit einer hohen Gebäudeeffizienz wirken, um Synergieeffekte zu nutzen. Gefördert werden sollte insbesondere die Kombination aus Dach-/Gebäudehüllensanierung und PV-Installation. Die Umsetzung der gebäudeintegrierten PV sollte erleichtert werden. Hierfür ist eine Vereinfachung der Mieterstrom-Regulierung sowie die Stärkung der Wirtschaftlichkeit der Mieterstrom-Konzepte durch eine grundlegende, bürokratiearme Neuordnung der Abgaben und Umlagen erforderlich.
Der durch PV-Anlagen am Gebäude erzeugte und in das Stromnetz eingespeiste EE-Strom steht zur Deckung des allgemeinen Strombedarfs zur Verfügung. Nach dem Quellprinzip wird die dadurch erzielte Minderung der THG-Emissionen der Strombereitstellung dem Energiesektor zugeordnet, obwohl Gebäudeeigen tümerinnen und eigentümer die PV-Anlagen planen und umsetzen sowie entsprechende Investi- tionen tätigen. Um dem Aufwuchs von PV-Anlagen im Gebäu- dekontext politisches Gewicht zu verleihen, ist es wichtig, gebäudenah erzeugten PV-Strom transparent zu machen und informatorisch zusätzlich auch im Gebäudesektor aus-zuweisen.
Das serielle Sanieren, zum Beispiel nach dem „Energiesprong“-Prinzip, muss schnell aus der Pilotphase herauswachsen, um Sanierungsprozesse deutlich zu beschleunigen.
Der Schritt aus der Pilotphase in die Markthochlaufphase kann gelingen, wenn die Produktion der Bauteile stärker automatisiert wird. Zudem besteht ein hoher Bedarf an Produktinnovationen, die eine einfachere, schnellere und hochqualitative Installation von Dämmelementen einschließlich Fenstern und Anlagentechnikmodulen auf der Baustelle ermöglichen. Organisatorisch unterstützt werden kann der Markthochlauf durch eine Geschäftsstelle „Serielle Sanierung“ als übergreifende europäische Plattform, die in enger Abstimmung mit Ländergeschäftsstellen agiert. Dies muss einhergehen mit einer verstärkten Investitionsförderung zum Aufbau von Produktionskapazitäten und Innovationen, der Verstetigung und dem Ausbau bestehender Förderung und einer strategischen Entwicklungs- und Wirtschaftsförderung durch die EU.
Im Rahmen der seriellen Sanierung spielt auch die Integration von PV in die Gebäudehülle eine Rolle. Dementsprechend sollten die Regelwerke kohärent, rechtssicher und transparent ausgestaltet sowie bürokratische Hemmnisse abgebaut werden, zum Beispiel im Bereich Mieterstrom und Baurecht. Weiterhin braucht es eine Verschlankung und Vereinfachung in den Planungs- und Genehmigungsprozessen, unterstützt durch Digitalisierung (digitaler Bauantrag, personelle und technische Ausstattung der Bauämter). Weitere Impulse könnte eine staatlich abgesicherte Nachfrage (z.B. über staatlich geförderte, große Ausschreibungen oder das Zurverfügungstellen öffentlicher Gebäude) geben.
Insgesamt müssen im Zuge des Transformationsprozesses effiziente Innovationen und Marktmodelle unterstützt werden (siehe Kapitel 3 „Innovation“). Die Rahmenbedingungen für einen Markthochlauf für Innovationen und Marktmodelle, die nachweislich zu einer Reduktion von THG-Emissionen führen, sollten innovationsfreundlich gestaltet werden.
Das aktuelle Niveau und der nach dem Brennstoffemissions- handelsgesetz (BEHG) für die Jahre bis 2025 bereits festge- legte zukünftige Pfad für den CO2-Preis im Gebäudesektor kann allein nicht ausreichend Wirkung für die Wärmewende entfalten. Damit der CO2-Preis eine stärkere Lenkungswir- kung erreicht und sinnvoll Investitionsentscheidungen getroffen werden können, ist die sukzessive Erhöhung des CO2-Preises auf Basis eines klaren Fahrplans erforderlich. Auf diese Weise können Selbstnutzerinnen und -nutzer zum
Umstieg auf eine Heizung auf Basis erneuerbarer Energien sowie Verbraucherinnen und Verbraucher zur Reduktion des Wärmebedarfs angereizt werden.
Im Mietwohnbereich ist eine sozialverträgliche Umsetzung bei gleichzeitiger Erhaltung der Investitionsfähigkeit von Vermietern zentral. Belastungen durch anwachsende CO2-Preise sollten dabei derart gestaltet werden, dass sie zu Investitio- nen führen. Abhängig von dem energetischen Zustand der Gebäude sollen die BEHG-Kosten zwischen Vermietern als denjenigen, die die Investitionsentscheidung treffen, und der Mieterschaft aufgeteilt werden. Der zu tragende Anteil orientiert sich an der im Energieausweis ausgewiesenen Effizienzklasse des Gebäudes: Bei den sehr schlechten Gebäuden der Effizienzklassen G und H (bei Mehrfamilienhäusern ca. 16 Prozent der Gebäude) übernimmt der Vermieter den kompletten Anteil der BEHG-Kosten, da er als Investitionsentscheider maßgeblich Maßnahmen zur energetischen Verbesserung initiieren kann. Bei guten Gebäuden der Klassen A+, A und B übernehmen die Mieterinnen und Mieter den vollständigen Anteil, da seitens der Gebäudeeigentümer hier bereits energetische Maßnahmen umgesetzt wurden und die Nutzungsgewohnheiten den Verbrauch stärker beeinflussen. Für Gebäude der mittleren Effizienzklassen wäre ein Mieteranteil von 70 % für die Klassen C und D sowie 40 % für E und F denkbar. Auf diese Weise sollen verstärkt Sanierungsaktivitäten ausgelöst werden. Spezifische Bedingungen, wie beispielsweise durch Denkmal- oder Milieuschutz auferlegte Restriktionen für die energetische Sanierung, sollten angemessen Berücksichtigung finden. Für Nichtwohngebäude müsste ein entsprechender Ansatz abhängig vom energetischen Zustand der Gebäude entwickelt werden.
Weiterhin muss die Belastung des Stroms aus erneuerbaren Quellen mit Steuern, Abgaben und Entgelten schrittweise reduziert werden, um den Hochlauf an Wärmepumpen im Gebäudesektor zu ermöglichen. Dies gilt insbesondere für die EEG-Umlage (siehe Kapitel 2 „Marktdesign“ und Kapitel 4 „Transformation“). Im Wärmesektor sollte hinsichtlich der staatlich induzierten Preisbestandteile ein „Level Playing Field“ geschaffen werden. Auch Gebäudebereiche, in denen CO2-Emissionen hauptsächlich durch Strombedarf entstehen (z. B. Lüftung, Kühlung, Beleuchtung in Nichtwohngebäuden), können so entlastet werden. In gleicher Weise sollte diese Entlastung auch für andere CO2-freie Energieträger diskutiert werden. Grundsätzlich muss eine verursacherge- rechte Kostenzuteilung sichergestellt werden, um Fehlsteuerungen zu vermeiden.
Verbraucherinnen und Verbraucher benötigen Transparenz und Planungssicherheit sowohl bei den Strom- als auch bei den CO2-Kosten, um Entscheidungen mit Blick auf die notwendige Klimaneutralität treffen zu können.
Wärmenetze bieten eine hohe Flexibilität durch die poten- zielle Einbindung von vielfältigen erneuerbaren Wärme- quellen und Wärmespeichern, womit auf die fluktuierende Erzeugung erneuerbarer Energien reagiert werden kann. Gleichzeitig basiert ein großer Anteil der Wärmeerzeugung in Wärmenetzen heute noch auf fossilen Energieträgern.
Die Dekarbonisierung von Nah- und Fernwärmenetzen im Bestand und über neue Quartierslösungen in Ballungsräu- men, aber auch in ländlicheren Regionen, muss vorangetrie- ben werden: Die Erhöhung der Menge an erneuerbarer und klimaneutraler Wärme in Neubau- und Bestandsnetzen durch Verbreiterung und bessere Ausstattung z. B. der Programme „Wärmenetze 4.0“ und „Energieeffiziente Wärmenetze“ ist ein Schlüssel dafür. Großwärmepumpen werden dabei eine zentrale Erzeugungstechnologie darstellen, daher ist die Schaffung eines „Level Playing Field“ mit Blick auf die Preisgestaltung erforderlich. Insbesondere bei der Tiefengeothermie müssen auch mögliche Risiken von Bohrungen berücksichtigt und abgefedert werden. Außerdem muss verstärkt die Nutzung weiterer erneuerbarer Quellen Berücksichtigung finden, beispielsweise durch Abwärmenutzung aus der Industrie, Solarthermiefelder oder nachhaltige Biomasse.
Die Planung von Wärmenetzen schafft mittel- bis langfristig Investitionssicherheit für die Verbraucherinnen und Verbraucher und die Investierenden. Dabei ist eine systemische Betrachtung von Wärmenetzen und angeschlossenen Gebäuden wichtig (z. B. hinsichtlich der erforderlichen Vorlauftemperaturen und des Wärmeschutzniveaus). Eine emissionsfreie Wärmeversorgung ist stark von den regionalen und lokalen Gegebenheiten (bestehende Infrastrukturen, energetische Potenziale, Energieträger) abhängig. Die strategische Einbettung der leitungsgebundenen Wärmeversorgung in eine verlässliche kommunale Wärmeplanung macht eine strategische gesamthafte Planung sowie eine effiziente Koordination erst möglich. Zudem kann sie die effektive Abstimmung von Strom-, Gas- und Wärmenetzinfrastrukturen ermöglichen (siehe Kapitel 2 „Marktdesign“). Dabei ist eine Verbesserung der personellen und finanziellen Ausstattung der Kommunen notwendig, damit diese eine hochwertige und umsetzungsorientierte Wärmeplanung einführen und umsetzen können. Diese muss ergänzt werden um eine gezielte Förderung
der Wärmeplanung selbst. Neben der kommunalen Ebene braucht es auch auf übergeordneten Ebenen ein Koordinierungsorgan, sodass eine enge Abstimmung zwischen Bund, Ländern und Kommunen erfolgen kann. Für die Akzeptanz von Nah- und Fernwärme ist eine transparente Kommunika- tion der Rahmenbedingungen notwendig.
Für den klimaneutralen Gebäudebetrieb sind THG-neutrale Brennstoffe notwendig. Zusätzlich zu den bereits genutzten biogenen Energieträgern und erneuerbarem Strom werden zukünftig insbesondere auch klimaneutrale synthetische Brennstoffe von zentraler Bedeutung sein. Um den hierfür notwendigen markt- und angebotsgetriebenen Hochlauf anzureizen, braucht es neben der Wirtschaft auch vonseiten der Politik ein Bekenntnis sowie Anreize und Vorgaben zur Erzeugung, Bereitstellung und Verteilung von klimaneu- tralen synthetischen Brennstoffen inklusive Klärung der technischen Umsetzung. Nur so kann mit Blick auf 2030 die Transformation der Energieversorgung, Herstellung und Netzwirtschaft vollzogen werden. Dies schafft Planungs- und Investitionssicherheit für Unternehmen sowie Verbraucherinnen und Verbraucher. In diesem Kontext könnten diese klimaneutralen synthetischen flüssigen und gasförmigen Brennstoffe im Sinne von Technologieoffenheit auch Teil der Regel-Erfüllungsoption im Gebäudeenergiegesetz werden. Ab 2025, sobald die entsprechenden (Nachrüst-)Technologien zur Verfügung stehen, ist ein Einbaugebot für H2-ready-Kessel denkbar, um verlorene Investitionen in diesem Bereich zu vermeiden. Von hohem Nutzen ist beim Markthochlauf die bereits bestehende Infrastruktur, die weiter- bzw. umgenutzt werden könnte.
Außerdem ist denkbar, flankierend zur CO2-Bepreisung eine steigende THG-Minderungsquote für klimaneutrale Energieträger zum Beispiel auf Basis von Zertifikaten einzuführen. Denn ein CO2-Preis allein führt nicht zur Dekarbonisierung innerhalb einer Heizungstechnologie, da Endkundinnen und Endkunden meist dort, wo ihnen die Entscheidung möglich ist, die preiswerteste Energie beziehen. Eine hochlaufende Unterquote kann für eine wirksame CO2-Minderung sorgen, den Aufbau von Erzeugungskapazitäten fördern und so die notwendige Transition hin zu klimaneutralen synthetischen Brennstoffen unterstützen (siehe Kapitel 2 „Marktdesign“).
Grundsätzlich sollte die Nutzung klimaneutraler gasförmi- ger und flüssiger Brennstoffe auch durch die Möglichkeit zur Anrechnung mit entsprechenden Primärenergiefaktoren bzw. CO2-Faktoren im Ordnungsrecht berücksichtigt werden. Im Bestand sollte die Nutzung dieser Brennstoffe dabei bevorzugt in den effizientesten Technologien zum Einsatz kommen.
Durch die Nutzung von digitalen Technologien und Gebäudeautomatisation lässt sich der Energieverbrauch reduzieren. Überdies kann das Nutzerverhalten mit Blick auf den Energieverbrauch transparent gemacht und korrigiert werden. Für die Transparenz müssen aber noch die Grundlagen für die Datennutzung (berechtigtes Interesse) geschaffen werden. Neben vermieteten Wohngebäuden können auch Nichtwohngebäude von einer intelligenten Steuerung profitieren, da hier unter anderem Lüftung und Klimatisierung sowie Abwärmenutzung eine größere Rolle spielen.
Gleichzeitig sind die Datenverwendung und die Interoperabilität zu verbessern: Wohnungsbezogene Energiedaten sollten für die Systemoptimierung verwendet werden dürfen, möglichst auch in der Umsetzung vom begleitenden Fachhandwerk. Dies bedarf einer eindeutigen datenschutzrechtlichen Erlaubnis. Interoperabilität als Anforderung an Schnittstellen zwischen Heizungsanlagen und Smart-Building-Technologien ist notwendig, um beispielsweise eine Heizungssteuerung, ein Monitoring des Heizungszustands sowie ein THG-Monitoring zu gewährleisten, sodass ein Datenaustausch stattfinden kann.
Aufgrund des großen THG-Minderungspotenzials sollten die schlechtesten Gebäude mit höchster Priorität modernisiert werden. Dies betrifft zunächst vor allem unsanierte Ein- und Zweifamilienhäuser, die häufig noch über ineffiziente Anlagentechnik und energetisch schlechte Gebäudehüllen verfügen. Hierfür müssen in einem vorgegebenen Zeitrahmen Vorgaben zur Energieeffizienz der Gebäude erfüllt werden. Eigentümerinnen und Eigentümer haben im definierten Zeitraum die Möglichkeit, die Planung und Umsetzung sukzessive, aber zielkonform durchzuführen. Nach der Modernisierung der schlechtesten Gebäude wird im Rahmen eines umfassenden mehrjährigen Stufenplans die Sanierung der nächstschlechtesten Gebäude angegangen. Instrumente wie der individuelle Sanierungsfahrplan sowie Sanierungsfahrpläne für Quartiere bzw. Klimastrategiepläne für größere Portfolios sollten in diesem Kontext gestärkt und ihre Aufstellung sollte unterstützt werden.
Bei einer ordnungsrechtlichen Regelung der Sanierung der schlechtesten Gebäude ist die enge Verzahnung mit Förder-, Planungs- und Beratungsinstrumenten unabdingbar. Dementsprechend greift das Prinzip „Fördern & Fordern“. Denkbar ist hier auch die Kopplung mit einem vollständig geförderten individuellen Sanierungsfahrplan. Mit eng ver- zahnten Beratungsangeboten kann unter anderem eine ineffiziente Mehrfachsanierung von Bauteilen vermieden werden. Ein Fokus muss dabei auch auf der Sozialverträglichkeit liegen, um soziale Härtefälle abzufedern und bezahlbare Mieten in vermieteten Beständen erhalten zu können. In diesem Zusammenhang sollte auch der soziale Wohnungsbau berücksichtigt werden.
Dem Prinzip „Worst first“ folgend, sollte auch im Bereich der Anlagentechnik eine Dynamik zum Austausch von ineffizienten Heizungsanlagen, bei Bedarf auch vor Erreichung eines Lebenszyklus von 30 Jahren, entfaltet werden. Neben einem auf Anreizen basierenden Mechanismus sollte es bei besonders ineffizienten Anlagen im Bestand Vorgaben geben, diese zugunsten einer verstärkten Nutzung erneuerbarer Energien sowie einer höheren Effizienz auszutauschen. Insbesondere die mit fossiler Energie betriebenen Standard- und Nieder- temperaturkessel sollten prioritär ausgetauscht werden, insofern sie nicht effizient mit klimaneutralen Energieträgern betrieben werden können. Auslösetatbestände wie beispielsweise der Verkauf von Gebäuden, können genutzt werden, um zum geeigneten Zeitpunkt Impulse zum Austausch alter, ineffizienter Anlagen zu setzen. Sie sollten verknüpft werden mit einem technologie- und energieträgerneutralen Einbindungsgebot erneuerbarer Energien.
Aktuell bestehen bereits ordnungsrechtliche Verpflichtungen, zum Beispiel bezüglich der Dämmung der obersten Geschossdecke, des Austauschs von über 30 Jahre alten, ineffizienten Heizkesseln oder der nachträglichen Dämmung von Heizungsleitungen im Keller. Die Vorgaben werden
heute allerdings nicht ausreichend umgesetzt und es existieren insbesondere in Ein- und Zweifamilienhäusern zu viele komplexe Ausnahmeregelungen. Daher sollte hier mit Blick auf die bestehenden Regelungen in erster Linie der Vollzug gestärkt werden.
Die Inspektionspflichten für strom-, wärme- und energieführende Anlagen sollten erweitert werden, insbesondere bei Inbetriebnahme der Anlagen sollten Vor-Ort-Kontrollen und Beratungsgespräche intensiviert werden, wobei die Quali- fikation der Fachexpertinnen und -experten sichergestellt werden muss.
Die heute gesetzlich festgelegten Anforderungen an das ener- getische Effizienzniveau von Neubauten garantieren noch nicht die Erreichung der Klimaziele im Gebäudesektor. Der gesetzlich geregelte Effizienzstandard von Neubauten sollte kurzfristig überprüft und zielgerecht erhöht werden, unter Berücksichtigung bauphysikalischer und bautechnischer Restriktionen im Rahmen der Statik sowie des Brand- und Schallschutzes. Bei einer deutlichen Erhöhung des Effizienzstandards ist zu berücksichtigen, wann Technologiesprünge entstehen, die zu deutlich höheren Kosten führen können. Dies könnte durch eine Förderung von gesetzlichen Anforderungen zur Steigerung der Energieeffizienz abgefedert werden, womit gleichzeitig auch die Markteinführung von Innovationen begünstigt wird. Eine derartige Förderung könnte über einen Zeitraum von mehreren Jahren jährlich reduziert werden. Vor allem im Nichtwohngebäudebereich ist das Zusammenspiel aus Gebäudehülle, Heizbedarf im Winter und dem etwaigen Bedarf an aktiver Sommerkühlung zu bedenken.
Für Neubauten sollte zukünftig zudem bundesweit eine Pflicht für die Integration von PV-Modulen oder auch Solarthermie gelten, sofern dies beim spezifischen Vorhaben unter Berücksichtigung wirtschaftlicher und bauphysikalischer Gegebenheiten (z. B. Verschattung, Dachausrichtung etc.) Sinn ergibt. Damit sind Synergieeffekte für die Erhöhung der Gebäudeenergieeffizienz verbunden. In diesem Zusammenhang muss zudem eine einfache lokale Verwendung des Stroms sichergestellt und geregelt werden. Ein zentraler Schritt in diese Richtung ist die ausstehende Umsetzung der neuen Vorgaben aus der europäischen Erneuerbaren-Energien-Richtlinie zur gemeinschaftlichen Eigenversorgung (siehe auch Kapitel 4 „Transformation“). Eine begleitende Förderung hoher Effizienzstandards sowie der Installation von PV- bzw. Solarthermie-Anlagen kann die Wirtschaftlich- keit für Investoren unterstützen.
Durch einen kleinteiligen, komplexen und zum Teil auch intransparenten rechtlichen Rahmen wird das Ziel der dezen- tralen und nachhaltigen Energieversorgung von Quartieren nicht erreicht. Der wirtschaftliche Betrieb von Quartieren muss in der Breite ermöglicht werden, damit die Potenziale einer effizienten Verzahnung von Strom-, Wärme-/Kälteversorgung und Mobilität zum Tragen kommen können.
Das Quartier als lokale Verbrauchs-, Erzeugungs- und Energiewandlungsebene sollte daher im Rechtsrahmen nachhaltig verankert werden. Dafür braucht es unter anderem eine konsistente Definition von Quartieren, die insbesondere die Potenziale von klimaneutraler Energieversorgung und Effizienzsteigerung berücksichtigt. Zudem sollte die Regulierung von Strom und Wärme für die Stärkung von Quartieren aufeinander abgestimmt werden, um lokale Sektorkopplung zu ermöglichen.
Priorität sollte haben, über eine Anpassung und Vereinheitlichung des regulatori-schen Rahmens die Umsetzungen im Quartier zu vereinfachen und damit die Praxistauglichkeit zu erhöhen.
Um das Quartier zum Klimaschutz-Vorranggebiet zu erklären, braucht es neben dem Abbau von Hemmnissen klare Impulse, so dass Quartiere auch wirtschaftlichen Mehrwert für die Beteiligten bieten: Dazu gehört die Befreiung der Quartiersebene von Abgaben und Umlagen sowie ein Förderzuschlag für Quartiere, die bestimmte Rahmenkriterien (einer neuen Quartiers-Definition folgend) erfüllen. Auf diese Weise können sich Quartierskonzepte in der Breite etablieren sowie ihr Potenziale zur Erreichung der Klimaneutralität entfalten. Der Bund sollte die Gestaltungsräume und das lokale Know- how der Kommunen nutzen und sie bei ihrer Quartiers-, Energieleit- und Wärmeplanung finanziell unterstützen.
Die Energieberatung sollte systematisch ausgeweitet werden. Mit Blick auf die heterogene Eigentümer-, Investoren-, Nutzer- und Gebäudestruktur ist eine individuelle Beratung unerlässlich, um die Zahl der energetischen Sanierungen sowie deren Effektivität zu steigern. Sowohl für Wohngebäude als auch für Nichtwohngebäude sollte die Beratung deutlich ausgeweitet werden. Energieberatung sollte dabei möglichst unkompliziert ausgestaltet sein, unter Wahrung der notwendigen Qualitätssicherung, um entsprechende Investitionen nicht auszubremsen. Maßnahmen zur Qualitätssicherung sollten dabei neben der Listung von qualifizierten Experten auch die stichprobenhafte Kontrolle von Unterlagen und der Umsetzung vor Ort sowie die umfassende Information der Eigentümer umfassen. Um insbesondere die großen Einsparpotenziale der „Worst Performing Buildings“ zu heben, sollte eine Beratung auch aufsuchend stattfinden: Energieberaterinnen und -berater sollten befähigt und befugt werden, proaktiv auf Eigentümerinnen und Eigentümer zuzugehen, um diese für energetische Sanierungsmaßnahmen zu sensibilisieren.
Parallel zur Ausweitung der Energieberatung ist es notwendig, die an verschiedenen Stellen bereits vorhandenen Gebäudeenergiedaten im Altbestand zusammenzuführen und den Marktteilnehmern zugänglich zu machen. In diesem Zusammenhang sollte außerdem analysiert werden, ob bei Bedarf weitere Daten erfasst werden sollten.
Energieausweise mit Verbrauchsdaten sind aktuell nur bei Verkauf und Vermietung von Gebäuden verfügbar. Eine stär- kere Durchdringung und Vereinheitlichung des Energieaus- weises möglichst hin zu belastbaren Bedarfsausweisen ist wichtig, um die Gebäude mit den schlechtesten Energieeffi- zienzwerten verlässlich zu identifizieren und ein genaueres Bild des Bestands zu bekommen. Aufgrund der begrenzten Ressourcen der Energieberaterinnen und -berater braucht es innovative und digitale Methoden zur flächendeckenden Erfassung des energetischen Zustands von Gebäuden.
Die Energieberatung sollte eng verzahnt mit der Inanspruchnahme von Förderung und ordnungsrechtlichen Instrumenten sein. Das heißt, Förderprogramme sollten eng gekoppelt mit einer entsprechenden Beratung durch qualifizierte Energieberaterinnen und -berater oder für bestimmte Einzelmaßnahmen durch die ausführenden Handwerksbetriebe (mit entsprechender Weiterbildung zum Energieberater) stattfinden. Gleiches gilt beispielsweise bei einer durch Vermietung oder Verkauf ausgelösten Sanierung.
„One Stop Shops“ auch auf regionaler Ebene können eine solche Verzahnung unterstützen. Der Aufbau solcher Anlauf- stellen, in denen sowohl Informationen als auch praktische Unterstützung bei Beratung, Planung, Finanzierung, Vorbereitung und Begleitung der Sanierungsmaßnahmen angeboten wird und die auf diese Weise niedrigschwellig und unkompliziert Sanierungsvorhaben ermöglichen, sollte gefördert werden.
Zentrales Instrument für die Energieberatung ist ein individueller Sanierungsfahr-plan (iSFP). Der iSFP geht individuell auf den Zustand der Gebäude sowie die Bedürfnisse der Eigentümerinnen und Eigentümer ein und ermöglicht eine Schritt-für-Schritt-Planung und sukzessive Umsetzung von Sanierungsmaßnahmen. Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) bezuschusst die Erstellung von iSFPs im Rahmen seines Förderprogramms für Wohngebäude- Energieberatungen.
In bestimmten Fällen, wie Vermietung, Verkauf oder Vererbung von sanierungsbedürftigen Gebäuden, sollte für Ein- und Zweifamilienhäuser die Erstellung eines iSFP als verpflichtendes Beratungsangebot festgelegt werden. In diesen Übergängen werden häufig Überlegungen zur Modernisierung und Sanierung von Gebäuden angestellt. Dement- sprechend sollten diese entscheidenden Phasen von fachlich qualifizierten Energieberaterinnen und -beratern begleitet und mithilfe eines iSFP professionell geplant und umgesetzt werden.
Eine enge Verknüpfung des iSFP mit dem Energieausweis ist sinnvoll. Zum Beispiel sollte die Erstellung eines iSFP Anlass geben, die erhobenen Daten zur Erstellung eines Energieaus- weises zu nutzen. Zudem sollten diese Instrumente in eine strategische kommunale Wärmeplanung eingebettet werden, um neben den individuellen Gebäuden auch die Gesamtsituation vor Ort im Blick zu haben.
Zukünftig sollte der individuelle Sanierungsfahrplan auch auf Nichtwohngebäude ausgeweitet und bezuschusst werden, um auch hier als Treiber für energetische Sanierungen zu wirken.
Insbesondere bei Wohnungsunternehmen, die über größere Bestände verfügen, kann die strategische Erstellung von Sanierungsfahrplänen auf Ebene des Gesamtportfolios sinnvoll sein, um hier zu einem konkreten Umsetzungsplan zu gelangen. Diese Portfolio-Fahrpläne sollten ebenfalls entwickelt und gefördert werden.
Die Transformation zu einem klimaneutralen Gebäude- bestand muss unter Einbeziehung der Öffentlichkeit und relevanter Stakeholder-Gruppen geschehen, da der Erfolg maßgeblich von ihrer Akzeptanz und ihren Entscheidungen und Verhaltensmustern abhängt. In diesem Kontext ist es zentral, die Energiewende und den Klimaschutz in Gebäuden motivierend zu gestalten und CO2-Minderungen positiv zu würdigen.
Kommunikationsoffensiven sollten in Form von Kampagnen, Plattformen zur Vernetzung und individueller persönlicher Beratung ausgestaltet werden. Hier sollten auch die zusätzlichen Vorteile einer energetischen Gebäudesanierung her- ausgestellt werden. Sie liegen zum Beispiel darin, den Wert des Gebäudes zu erhalten oder sogar zu steigern sowie die Bausubstanz zu sichern. Auch Dach- und Fassadenbegrünungen liefern z.B. einen zusätzlichen positiven Effekt im Sinne der Anpassung an den Klimawandel sowie der Verbesserung der Aufenthaltsqualität in Gebäuden und Städten.
Neben einer breiten Öffentlichkeitswirksamkeit ist eine zielgruppenspezifische Ansprache von Akteuren erforderlich, beispielsweise zur Gewinnung und Qualifizierung von Fachkräften im Handwerk.
Die deutsche Industrie trägt mit über 6 Millionen direkt Beschäftigten in mehr als 45.000 Betrieben erheblich zum Wohlstand des Landes bei. Insgesamt verursachte der Industriesektor im Jahr 2018 rund 190 Millionen Tonnen direkte CO2-Emissionen, fast ein Viertel des deutschen THG-Ausstoßes. Damit die Industrie klimaneutral produziert, müssen die bestehenden, auf fossilen Ressourcen basierenden Produktionsprozesse weiterentwickelt oder komplett durch neue Produktions- und Prozesstechnologien ersetzt werden.
Die Bundesregierung sollte Anreize und Förderung für Energieeffizienz stärken, um Investitionen durch verkürzte Amortisationszeiten und reduzierte Risiken wirtschaftlicher zu gestalten. Hierfür sind insbesondere bestehende Förderprogramme wie „Energieeffizienz in der Wirtschaft“ sind wei- terzuführen und zu verbessern. Dabei sollten die Programme jedoch konsequenter auf die Reduzierung von THG-Emissi- onen ausgerichtet werden. Anstatt des spezifischen Energie- verbrauchs im Vergleich zu Referenzanlagen allein, sollten auch die tatsächlichen absoluten Emissionsreduktionen als Kernkriterium für Förderung herangezogen werden. Anlagen, die zu einer Erhöhung der Emissionen führen, sollten nicht mehr gefördert werden.
Bei Neuanlagen sollte dabei verpflichtend die jeweils effi- zienteste Technologie zum Einsatz kommen. Insbesondere sollten Anlagen, die nicht Klimaneutralitäts-kompatibel sind (die also nicht auf klimaneutrale Energieträger und Roh- stoffe umgestellt bzw. deren Weiterbetrieb bei Erreichung
der Klimaziele nicht mehr möglich sein wird) nur noch in Ausnahmefällen gefördert werden, zum Beispiel bei Erzielung besonders hoher kurzfristiger Emissionsminderungen inner- halb der Laufzeit. Kleine und mittelständische Unternehmen sollten beim Aufbau klimaneutraler Produktionsanlagen besonders unterstützt werden (siehe unten).
Für Investitionen zur Steigerung der Energieeffizienz oder Minderung der THG-Emissionen sollten kürzere Abschreibungszeiten eingeführt werden, um die Amortisationszeiten zu verkürzen. Der Zugang zu zinsgünstigen Krediten für diese Investitionen sollte weiter vereinfacht werden, dies gilt auch für Contracting-Anbieter.
Die bestehenden Abgabenbefreiungen auf Energie- und CO2- Preise sowie sonstige Vergünstigungen sollten auf Anreizkompatibilität und Notwendigkeit überprüft werden. Insbesondere sollte die Regulierung industrieller Energieverbraucher systematisch auf Fehlanreize untersucht werden und diese rasch abgebaut werden:
Fehlanreize in Carbon Leakage Maßnahmen sollten abgebaut werden, etwa durch eine Stärkung der Steuerungswirkung des BEHG durch Anpassung der zugehörigen Carbon Leakage Verordnung: Inkrementelle THG-Einsparungen durch Unternehmen müssen zu einer Entlastung in Höhe des CO2-Preises führen, wie es auch im „Benchmark-Ansatz“ im EU ETS bereits implementiert
ist. Auszahlungen im Rahmen eines Carbon Leakage Schutzes sollten dabei an die Bedingung geknüpft werden, für Maßnahmen und
Transformationsprojekte hin zur Klimaneutralität genutzt zu werden (wie Energieeffizienzprojekte oder andere THG-Einsparmaßnahmen).
Zur Erhöhung der Anteile erneuerbarer Energien unter Berücksichtigung der gesamtsystemischen Effizienz sind zusätzliche Maßnahmen auf anderen Ebenen notwendig:
Beschleunigter Ausbau der erneuerbaren Energien im Inland, um die weitere Elektrifizierung der Industrie (z. B. für Prozesswärme) zu ermöglichen und die Abhängig- keit von importierten erneuerbaren Energieträgern zu reduzieren. Zudem schneller Aufbau von Energiepartnerschaften zum Import von Wasserstoff und anderen Powerfuels aus dem EU- und nicht-EU-Ausland.
Die erneuerbare Stromerzeugung durch PV und Windkraft in Industrieanlagen sollte ausgebaut werden. Hierzu sind neben einer PV-Pflicht für Neubauten (sowie für Bestandsgebäude im Falle von wesentlichen Umbauten des Daches) eine Abgabenbefreiung für Eigenver- brauch und die Vereinfachung von Genehmigungsverfahren sinnvoll.
Green PPAs (langfristige Stromabnahmeverträge) stellen für Unternehmen eine Möglichkeit dar, sich ohne Kapitalaufwand für eigene Erzeugungsanlagen mit wettbewerbsfähigem grünem Strom zu versorgen und den EE-Ausbau nachfragebasiert voranzutreiben. Daher sollte der Abschluss dieser Verträge durch Maßnahmen auf der Anbieter- und der Nachfragerseite erleichtert werden. Dazu gehören beispielsweise die Ermöglichung der Strompreiskompensation für den Grünstrombezug für energieintensive Unternehmen und die Erleichterung von Pooling-Modellen für die kollektive Stromabnahme durch mittelgroße Industrieunternehmen
Um neue Technologien (beispielsweise Abwärmeverstro- mung, Groß- und Hochtemperatur-Wärmepumpen, Geother- mie oder industrielle Solarthermie) schneller auf dem Markt zu etablieren sind in den kommenden Jahren spezifische För- derungen als Anschubfinanzierung sinnvoll. Ein Mittel dafür könnten technologiebezogene Ausschreibungen oder ein erhöhter Fördersatz im Rahmen von Energieeffizienz-Förder- programmen sein.
Die Bundesregierung soll aufbauend auf bestehenden Ansät- zen die Erarbeitung einer Circular-Economy-Strategie anstoßen, um ambitionierte Ziele bezüglich Material- und Ressourceneffizienz anzustreben.
Designstandards sollten gestärkt werden und zu effiziente- rem Materialeinsatz führen, indem die Ökodesign-Richtlinie ausgeweitet wird von der reinen Bewertung des Energieverbrauchs im Betrieb hin zu einer Lebenszyklus-Betrachtung (Produktion, Verpackung, End-of-Life etc.). Dadurch sollen Produkte materialeffizienter und langlebiger konzipiert werden. Als Anreiz wären auch eine preisliche Bevorzugung effizienter Produkte oder verpflichtende Standards möglich.24
Konsistente, verbindliche Regelungen sollen zu mehr Effi- zienz und weniger Primärstoffeinsatz führen. Dies kann erreicht werden durch branchenspezifische Recyclingquo- ten (bzw. Quoten für den Sekundärrohstoffeinsatz) und konkrete Zielvorgaben zum Einsatz von Recyclingmaterialien unter Berücksichtigung der Ökobilanzen und Verfügbarkeiten von Sekundärrohstoffen.
Zur Erhöhung der Recyclinganteile, Abfallvermeidung, Verringerung des Primärmaterialeinsatzes und Stärkung des Sekundärrohstoffmarkts branchenspezifischer finanzieller Anreize geschaffen werden: Für geeignete Materialkategorien sollte eine Abgabe auf importierte und in Deutschland produzierte Primärrohstoffe erhoben werden, die sich an objektiven Kriterien wie THG-Emissionen, Energieintensität oder anderen ökologischen Auswirkungen orientiert und bei Inverkehrbringen erhoben wird. Für die Einführung dieser Abgabe sollten für die jeweilige Stoffkategorie die Lenkungswirkung, Bürokratieaufwand, Nebeneffekte, sowie mögliche Wechselwirkungen mit anderen Instrumenten evaluiert werden.
Eine weitere Option wäre eine Abgabe für nicht verwerteten Müll oder Schutt (Deponiesteuer).
Zusätzlich ist die Einführung einer Abgabe auf Primärroh- stoffe (siehe 7.1) zu prüfen, um die Anreize für Materialeinsparungen und die Erhöhung von Recyclinganteilen zu erhöhen.
Die Entwicklung und Anpassung von Designstandards soll erreichen, dass die Nutzung von Produkten über den Gesamt- lebenszyklus effizienter wird. Ansätze sind dabei:
Abbau von Hindernissen: Standards und Normen sollten darauf überprüft werden, ob sie aktuell den Einsatz von Sekundärrohstoffen oder neuen materialsparsamen Verfah-ren erschweren, insbesondere im Baubereich. Unter anderem sollten qualitätsgesicherte Sekundärrohstoffe am Ende des Aufbereitungsprozesses ihre Abfalleigenschaft verlieren. Der Umgang mit den Sekundärrohstoffen würde dadurch verein- facht und ihre Verwendung im Produktionsprozess erleichtert.
Die Umstellung auf eine Kreislaufwirtschaft könnte zusätzlich auch durch ordnungsrechtliche Vorgaben unterstützt werden:
Zur Erhöhung der Rückführquote für Produkte und Verpackungen, sollten bestehende Pfandsysteme in Deutschland weiterentwickelt und auf weitere Produktkategorien ver- pflichtend ausgeweitet werden, wie zum Beispiel Elektronik- geräte oder Batterien.
Konkrete Vorschriften für die End-of-Life-Phase in der Produktnutzung: Produkte sollten schon so konzipiert werden, dass eine möglichst gute Rückgewinnung der verbauten Roh- stoffe und Recycelbarkeit ermöglicht wird.
Müllverbrennungsanlagen für Abfallströme, die keiner stoff- lichen Verwertung zugeführt werden können und daher ther- misch verwertet werden müssen, sollten im Laufe der 2030er- Jahre mit einer CO2-Abscheidung ausgestattet werden, um einen weitgehend geschlossenen Kohlenstoffkreislauf sicherzustellen. Eine Erfassung der Abfallwirtschaft in den EU ETS würde helfen, dort anfallende Emissionen genauer zu er- fassen und Anreize zu deren Vermeidung bzw. Abscheidung zu setzen.
Um Wertstoffe möglichst vollständig im Kreislauf zu führen und unsachgemäße Entsorgung zu vermeiden, sollten Müll- und Schrottexporte in Nicht-EU-Länder reduziert und weit- gehend verboten werden, es sei denn, es kann sichergestellt werden, dass im Zielland eine hochwertige Wiederverwer- tung durchgeführt wird. Für besonders umweltbelastende oder leicht substituierbare Produktkategorien sollten Ver- bote des Inverkehrbringens analog zum EU-Einwegplastik- verbot geprüft werden.
Energieaudits sollten im Sinne eines Umweltaudits um die Themen THG-Emissionsminderung und Ressourceneinspa- rung erweitert werden. Zusätzlich sollten die Unternehmen durch ein Beratungsprogramm bei der Umstellung auf eine Kreislaufwirtschaft unterstützt und notwendige Investitionen in Maßnahmen zur Einsparung von Ressourcen und Material gefördert werden.
Um die durch Produkte und Leistungen verursachten THG- Emissionen bei Kaufentscheidungen berücksichtigen zu können, müssen Informationen hierüber sowohl im zwischenbetrieblichen Handel (B2B) als auch für die Verbraucherinnen und Verbraucher verfügbar sein.
Zudem sollten Richtlinien zu nachhaltigem, THG-armem Einkauf als auch zu nachhaltiger und THG-armer Produktion erarbeitet werden (z. B. unter Einbindung der Energieeffizi- enz- und Klimaschutz-Netzwerke oder anderer Unterneh- mensinitiativen). Auch sollte geprüft werden, das Lieferket- tengesetz um eine entsprechende Verpflichtung zu erweitern.
In Ergänzung zur Schaffung von Transparenz und der Ent- wicklung von Regelungen für eine THG-arme Beschaffung sollte eine Verbrauchsabgabe auf Endprodukte eingeführt werden, die sich am Energieverbrauch und THG-Fußab- druck bemisst. Die Abgabe sollte so gestaltet sein, dass sie Lenkungswirkung auf Konsum- bzw. Kaufentscheidungen entfalten kann. Die hierüber erwirtschafteten Mittel könnten zur Refinanzierung von CCfD sowie zum sozialen Ausgleich (wo erforderlich) verwendet werden.
Derzeit ist die klimaneutrale Erzeugung im Vergleich zur Pro- duktion mit etablierten, aber emissionsintensiveren, Verfahren für die meisten Produkte mit höheren Kosten verbunden. Gründe hierfür sind etwa die kleineren Produktionsvolumina (geringere Skaleneffekte) und höhere Investitions- sowie Betriebs- und Energieträgerkosten. Klimaneutrale Produkte sind daher typischerweise in frühen Phasen des Einsatzes neuer emissionsarmer Produktionsverfahren bzw. erneuerbarer Energieträger und Rohstoffe noch nicht preislich wettbewerbsfähig.
Um trotzdem eine ausreichend hohe Nachfrage nach klimaneutral erzeugten Produkten zu schaffen und damit die langfristigen Investitionen in die Umstellung der Produk- tion zu ermöglichen, sollten frühzeitig „grüne Leitmärkte“ für klimaneutrale und recycelte Produkte und Grundstoffe geschaffen werden.
Hierbei sollten folgende einander ergänzende Ebenen betrachtet werden:
Die Bundesregierung sollte schnellstmöglich Parameter und Vertragsbedingungen für den Einsatz von CO2-Differenzverträgen (Carbon Contracts for Difference, CCfD) im Rahmen eines CCfD-Programms ausarbeiten, um bereits im ersten Halbjahr 2022 erste Ausschreibungen durchführen zu können. Nach einer ersten erfolgreichen Durchführung sollten Finanzierung und Ausschreibungsmengen entsprechend ausgeweitet werden, um die Sektorziele für 2030 erreichen zu können. Dabei sollte geprüft werden, welche Branchen bzw. Produkte unterstützt werden sollten, und wie CCfD möglichst effizient mit anderen Instrumenten verzahnt werden können.
Die Bundesregierung sollte daneben die Investitionsförderung für den Einsatz und Hochlauf von emissionsarmen Produktionstechnologien und -verfahren (Low Carbon Breakt- hrough Technologies, LCBT) ausweiten, um den Ausbau in industriellem Maßstab anzustoßen und Hemmnisse abzu- bauen. Hierzu sollte neben der Schaffung neuer unterstützender Finanzierungsinstrumente insbesondere die Finanzierung der „Reallabore der Energiewende“ ausgeweitet werden, um Technologien und Anwendungen möglichst schnell hochzuskalieren. Begleitend sollten Planungs-, Genehmigungs- und Beteiligungsverfahren vereinfacht und beschleunigt werden, um größere Investitions- und Umbauprojekte zu erleichtern.
Aus industriepolitischer Sicht sollte der zunehmende Einsatz von LCBT in der heimischen Industrie durch ein Programm zur Exportförderung für Klimatechnologien flankiert wer- den, um den Hochlauf von LCBT auch im Ausland zu unter- stützen. Hierdurch können Marktchancen für den deutschen Maschinen- und Anlagenbau durch die globale Transformation zu Klimaneutralität geschaffen bzw. genutzt werden und gleichzeitig auch Lernkurven und Kostendegressionen für die globale Energiewende beschleunigt werden.
Für die erfolgreiche Transformation zu Klimaneutralität der deutschen Industrie müssen neben den häufig großen Unternehmen aus den emissions- oder energieintensiven Branchen auch der Mittelstand und die große Zahl kleinerer und mittlerer Unternehmen (KMU) und Betriebe ‚mitgenom- men‘ werden.
Hierfür sollte speziell für den Mittelstand und KMU ein Beratungsprogramm entwickelt werden. Im Rahmen dieses Programms kann für die Unternehmen konkret ein „individueller Transformationsfahrplan“ (iTFP-KMU) erarbeitet werden, der in Form eines Energie- und Klimaaudits den Status Quo feststellt und einen möglichen Weg zum Umbau der Produktion hin zur Klimaneutralität beschreibt. In Abhängigkeit von den örtlichen Gegebenheiten und der langfristig geplanten Entwicklung der (Energie-)Infrastrukturen werden die Unternehmen gegebenenfalls auch bei der Beantragung von Fördergeldern unterstützt.
Mit Einführung des Programms sollte eine Ausweitung der Pflicht zur Erstellung eines Energie- und Klimaaudits auf diese Unternehmen erfolgen. Zudem sollte für besonders wirtschaftliche Maßnahmen aus Energieaudits eine Begründungspflicht eingeführt werden, falls die empfohlenen Maßnahmen nicht umgesetzt werden. Für besonders emissionsintensive bzw. ineffiziente Altanlagen sollte ein obligatorischer Phase-out im Rahmen eines Energieeffizienz-Fahrplans festgelegt werden können, um den Weiterbetrieb überholter Anlagen zu minimieren.
Eine Sonderförderung „Kohle-Ausstieg in der Industrie“ sollte als „Quick Win“ für den Klimaschutz wie auch zur Sicherung der Zukunftsfähigkeit der betroffenen Unternehmen, den direkten „Fuel Switch“ von Kohle zu erneuerbaren Energieträgern bzw. klimaneutralen Verfahren ermöglichen.
Viele der in diesem Kapitel empfohlenen Maßnahmen können für kleine und mittlere Unternehmen schwierig sein. Wo erforderlich sollte die Umsetzung also zusätzlich gefördert werden, insbesondere, wo neue technische oder administrative Prozesse eingeführt werden müssen (z. B. Ersterstellung einer Unternehmensklimabilanz).
Energieeffizienz muss in Zukunft stärker intersektoral gedacht werden. Dies beinhaltet die überbetriebliche Nutzung verfügbarer (Ab-)Wärmequellen. Industrieunterneh- men sollten dabei stärker in Wärmenetze, Quartierskonzepte und andere Formen der betriebsübergreifenden Wärmenut- zung eingebunden werden, um Primärenergie einzusparen und die Effizienz des Gesamtsystems zu verbessern.
Dafür sollten stärkere Anreize für die Nutzung von nicht- vermeidbarer Abwärme in benachbarten Betrieben oder die Einspeisung in Wärmenetze gesetzt werden. Auch sollte der Aufbau gemeinsamer Wärmeerzeuger aus erneuerbaren Energien sowie der Bezug von Energie aus Wärmenetzen (wo energetisch sinnvoll) stärker angereizt werden. Um Hindernisse abzubauen, sind dabei verschiedene Maßnahmen sinnvoll:
Um die Potenziale durch die stärkere deutschlandweite Nutzung von nicht-vermeidbarer Abwärme zu ermitteln und konkrete regionale Konzepte zur Abwärmenutzung zu ermöglichen, sollte ein deutschlandweites Abwärmekataster (Wärmeatlas) nach dem Vorbild einzelner Bundesländer erstellt werden.
Bei situativem Marktversagen könnten größere Abwärme- Emissionen auch über das Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) reguliert werden.
Die Emissionen im Verkehrssektor stagnieren. Klimapolitisches Ziel ist, bis 2030 mindestens 48 Prozent weniger CO2 im Verkehr gegenüber 1990 zu emittieren. Auch danach steigt das Ambitionsniveau kontinuierlich. Passende Technologien, Energieträger sowie IT- und Mobilitätskonzepte sind verfügbar – durch fehlende Rahmenbedingungen kommen diese jedoch nicht zum Tragen. Bisweilen gibt es aktuell sogar noch Marktentwicklungen und Trends, die gegenläufig zum Ziel der Klimaneutralität sind.
Die Bundesregierung hat sich ambitionierte Ziele für den Markthochlauf von elektrifizierten Antrieben gesteckt. Nachdem in den vergangenen zwei Jahren die Marktentwicklung durch hohe Fördersummen gestützt wurde, muss die kommende Bundesregierung den wirtschaftlichen Rahmen für gewerbliche und private Verbraucherinnen und Verbraucher bereiten, sodass eine sich selbst tragende Entwicklung erfolgen kann. Dies muss auch dazu führen, dass sich die Infrastruktur perspektivisch selbst trägt. Wenn Fördergelder in den Aufbau von Betankungs- oder Ladeinfrastruktur fließen, sollten diese für die Entwicklung öffentlich zugänglicher Infrastrukturen eingesetzt werden, um Kostennachteile von Verbraucherinnen und Verbrauchern ohne Zugang zu privater Ladeinfrastruktur zu reduzieren.
Verbraucherinnen und Verbraucher zeigen typischerweise eine eher niedrige Preissensitivität bezüglich ihrer Individualmobilität (auch deutlich höhere Kraftstoffpreise führen nur zu einem geringen Rückgang des Spritabsatzes). Über das Instrument der THG-Minderungsquote besteht daher die Chance, den Anteil erneuerbarer Energieträger ohne öffentliche Fördermaßnahmen zu steigern und somit die Emissionen im Verkehr zu reduzieren.
Im Güterverkehr könnten durch freiwillige Instrumente (z. B. ein grünes Label) über die Quoten hinausgehende Mengen an erneuerbarem Strom bzw. erneuerbaren gasförmigen oder flüssigen Kraftstoffen in den Markt gelangen, wenn sie anderweitig angerechnet werden können (zum Beispiel bei Maut- oder Flottenzielwerten). Von der Nachfrageentwicklung und Skalenerträgen könnten zukünftig wiederum auch andere Sektoren im internationalen Wettbewerbsumfeld mit geringeren Zahlungspotenzialen profitieren.
Da gerade Haushalte mit geringen Einkommen auf öffentliche Verkehre angewiesen sind, müssen deren Bedeutung und Qualität gestärkt werden. Öffentliche Fördergelder sollten daher in einen Ausbau des Angebots und in eine bessere Verknüpfung mit geteilten Verkehrsangeboten investiert werden.
Ein nachhaltigerer, gleichfalls bedarfsgerechter Verkehr sollte die regional spezifischen Herausforderungen adressieren. Eine umfangreiche Anpassung des Straßenverkehrsrechts sollte daher so schnell wie möglich angegangen werden, um Kommunen mehr Spielraum bei der Planung und bei Eingriffen im Straßenraum zu geben. Flankiert werden sollten diese wichtigen regulatorische Anpassungen durch innovative Pilotprojekte, z.B. City Maut Projekte unter Einbezug innovativer verkehrsplanerischer Ansätze und Mobilitätsangebote.
Die Stärkung des Umweltverbunds im Verkehr scheitert der- zeit auch an langen Planungsverfahren für Bahntrassen oder Radwege. Hinzu kommen langwierige Baumaßnahmen. Die Bundesregierung muss daher dringend Wege suchen, um das Planungsrecht weiter zu vereinfachen und Verfahren zu beschleunigen. Gleichfalls müssen Genehmigungskompetenzen mit entsprechenden personellen Ressourcen auf Landes- und Kommunalebene erhöht werden, um die Anträge schnell zu bearbeiten. Da davon auszugehen ist, dass gerade im Schienenverkehr die gewünschten Potenziale durch infrastrukturelle und planerische Defizite nicht schnell genug aufgebaut werden können, sollte insbesondere in den 2020er Jahren Regional- und Fernbussen als Teil des Verkehrssys- tems eine größere Aufmerksamkeit zukommen.
Der bisherige energiesteuerliche und Kfz-steuerliche Rahmen sendet noch nicht genügend Impulse für Investitionen in effiziente Fahrzeuge oder erneuerbare Kraftstoffe. Gleichfalls werden bei stärkerer Marktdurchdringung von elektrifizierten Fahrzeugen die steuerlichen Einnahmen deutlich sinken. Daher muss die kommende Bundesregierung eine grundlegende Anpassung der energie- und verkehrsseitigen Steuern sowie Abgaben vornehmen, die auf Treibhausgasminderun- gen ausgerichtet sind, jedoch mittelfristig Einnahmen aus dem Verkehr sichern. Dabei ist zu berücksichtigen, dass über die derzeitige Energiebesteuerung von Kraftstoffen erhebliche Finanzmittel für den Auf- und Ausbau bzw. Erhalt der Verkehrsinfrastrukturen erzielt werden. Dies ist auch bei einer Reform staatlicher Steuern und Abgaben zu berücksichtigen.
Mit dem „Fit for 55“-Paket hat die EU-Kommission einen umfangreichen Vorschlag für verschiedenste Bereiche des Verkehrs und des Energiemarktes gemacht. Gerade für den international geprägten Luftverkehr sollten die Anforderungen der ReFuelAviation mit dem nationalen Zielniveau von SAF in Übereinstimmung gebracht werden. Darüber hinaus müssten Instrumente zur CO2-abhängigen Bepreisung wie BEHG, Energiesteuer und sektoraler ETS darauf geprüft werden, ob und inwiefern sie nebeneinander existieren können.
In den Mittelpunkt der Klimaschutzbemühungen müssen in den kommenden Jahren adäquate Folgekosten der Emissionen aus fossilen Quellen treten. Staatliche Instrumente, die THG-Emissionen begünstigen, müssen dementsprechend abgebaut werden. Dies stärkt Effizienztechnologien, erneuerbare Kraftstoffe und den Umweltverbund. Sozial besonders belastete Haushalte sollten nicht pauschal für höhere Kosten kompensiert werden, sondern über zielgerichtete Zuschüsse in den Lebensbereichen, die am stärksten ihre Grundbedürf- nisse und ihre soziale Teilhabe betreffen.
Die stärkere Durchdringung des Marktes mit elektrifizierten Fahrzeugen, aber auch die weitere Digitalisierung wird zu Stellenabbau und veränderten Stellenanforderungen führen. Gleichzeitig wird es im Bereich Softwareengineering und für den Aufbau und die Wartung der Ladeinfrastruktur sowie im Bereich von Planungsprozessen einen erhöhten Bedarf an qualifizierten Fachkräften geben. Die dem Bedarf entsprechende Ausbildung und Umschulung muss hohe Priorität besitzen und beispielsweise durch Fördermaßnahmen wie den Zukunftsfonds Automobilindustrie hinterlegt werden.
Die bestehenden Entwicklungspfade für einen klimaneutralen Stromsektor sind grundsätzlich richtig angelegt. Die zukünftige Energieversorgung funktioniert mit erneuerbarem Strom, Bioenergie sowie klimaneutralem Wasserstoff und Powerfuels in einem integrierten Energiesystem. Die Bedeutung von Strom als Endenergieträger wird stark zunehmen. Erneuerbare Energien sind im Stromsektor zwar auf dem Vormarsch, doch im Wärme- und Verkehrssektor dominieren noch immer fossile Energieträger.
Die Bundesregierung sollte im Rahmen der Novellierung des EEG zügig Anpassungen des Fördermechanismus für erneuerbare Energien auf den Weg bringen. Wesentliche Elemente sind dabei die Anhebung der Ausbauziele, die Erhöhung gesetzlicher Ausbaupfade und die entsprechende Anpassung der Ausschreibungsvolumina (Beibehaltung der Ausschreibungsverfahren). Parallel dazu muss es zu einer Beschleunigung der Ausweisung zur Verfügung stehender Flächen kom-men. Auch sollte eine Erleichterung des Genehmigungsrahmens für „Repowering“-Projekte sichergestellt werden.
Sowohl im Neuanlagenbereich als auch im Bereich des Weiter- betriebs von sogenannten Ü20-Anlagen (also EE-Stromerzeugungsanlagen nach Ablauf der zwanzigjährigen EEG-Einspeisevergütung) sollten die Rahmenbedingungen für Investitionenin Anlagen verbessert werden, die ihre Energieerzeugung über Stromlieferverträge (Power Purchase Agreements, PPA) direkt- vermarkten. Ziel ist die Einführung einer weiteren stabilen Säule des förderfreien EE-Ausbaus neben dem EEG, um der Nachfrage der Wirtschaft nach grünem Strom zu entsprechen. Dies kann angebotsseitig zum Beispiel über die Erleichterung der Finanzierungsbedingungen für PPAs erfolgen.
Als nachfrageseitige Maßnahme sollten Unternehmen künf- tig auch für den Bezug von Grünstrom die Strompreiskom- pensation der Deutschen Emissionsh andelsstelle (DEHSt) in Anspruch nehmen können. Mit Blick auf die Schaffung sich selbst tragender Geschäftsmodelle sollten künftig im Grund- satz keine Anschlussförderungen für EEG-Altanlagen mehr geleistet werden. Investoren in PPA sollten Steuervergünstigungen erhalten. Zudem sollte geprüft werden, inwiefern Risiken über marktliche oder staatliche Mechanismen für die Vertragsparteien minimiert werden können.
In enger Kooperation mit den Landesregierungen sollte die Bundesregierung zur Verbesserung und Beschleunigung der Flächenbereitstellung für Flächen für Wind an Land und PV- Freiflächenanlagen sorgen. Dafür gilt es die vergütungsfähigen Flächenkategorien zu liberalisieren und die Entscheidungsbefugnisse für die Ausweisung von Flächen in den Händen der Gemeinden und Bundesländer zu stärken. Es ist darüber hinaus zu prüfen, inwieweit verbindliche Ziele für die Bereitstellung von Flächen für die erneuerbare Stromerzeugung auf Basis der Klimaziele bundesweit definiert und auf Länder- bis Kommunenebene heruntergebrochen werden können. Aktuell geltende Abstandsregelungen sollten mit Blick auf die erforderlichen Ausbauzahlen überprüft und reduziert werden.
Durch Vereinfachung und Vereinheitlichung der Schritte und Verfahren muss eine Verbesserung und Beschleunigung der Genehmigungsprozesse für Investitionsvorhaben in erneuerbare Energien erreicht werden. Dies kann beispielsweise durch die Vereinfachung und Bündelung der Geneh- migungsverfahren bei einer einzigen Behörde mit ausreichender Personaldecke und Digitalisierung der Verwaltungsabläufe geschehen. Ergänzend sollte eine Unterstützung der ausführenden Behörde durch einen Expertenpool (z. B. zu Naturschutzfragen) erfolgen. Zudem ist rechtlich zu prüfen, ob zur Beschleunigung der Verfahren die Genehmigung (z. B. für einen Windpark) durch die Genehmigungsbehörde als erteilt gelten kann, wenn sie den Antrag nach einer bestimmten Zeitspanne nicht final abgelehnt hat. Das Naturschutzrecht bzw. das Artenschutzrecht sollten so weiterentwickelt werden, dass die dortigen Rechtsvorschriften mit dem EE-Ausbau besser in Einklang gebracht werden können. Eine Neujustierung von Umwelt- und Klimaschutz durch länderübergreifend einheitliche Regelungen und differenzierte Anforderungen bei der naturschutzfachlichen Kompensation bei Projekten mit deutlichem Beitrag zum Klimaschutz kann ebenfalls zur verbesserten Bereitstellung von Flächen beitragen.
Die Bundesregierung sollte über ein geeignetes und abgestimmtes Set an Instrumenten unter Berücksichtigung der perspektivischen Bedeutung des Energieträgers im jeweiligen Sektor eine ausreichende Gesamtnachfrage nach klimaneutralen Energieträgern stimulieren. Dazu gehören Leitmärkte für grüne Produkte (z. B. Grünstahlquote), der Einsatz von sektorspezifischen CO2-Differenzverträgen (CCfD), sowie die Prüfung von Quotenmodellen für bestimmte Sektoren (Wärmesektor, Verkehrssektor). Die Zielgröße für die Gesamtnachfrage nach klimaneutralen Energieträgern sollte sich an der Nationalen Wasserstoffstrategie und perspektivisch an den Ergebnissen des Systementwicklungsplans orientieren.
Die Bundesregierung sollte den Nachteilen für die ersten ent- stehenden Projekte für Elektrolyseure (First Mover Disadvantage) für einen ausreichenden aber begrenzten Zeitraum eine für Projekte im industriellen Maßstab sowie für kleinskalige Projekte begegnen. Bestehende Förderansätze, wie das IPCEI Hydrogen, sind zu prüfen und gegebenenfalls zu erweitern. Dabei sind die Anforderungen an die öffentlichen Haushalte zu begrenzen.
Für eine schnelle technologische Entwicklung und schnelle Lernkurven sollten das Bundes- und die Landesforschungsprogramme weiter gezielt Forschung und Entwicklung nah an der industriellen Umsetzung fördern, um den Markthochlauf für Wasserstoff und Powerfuels eng zu flankieren. Dies betrifft die Weiterentwicklung der Elektrolyseverfahren und aller Infrastrukturkomponenten sowie der verwendeten Materialien, aber auch alternative Erzeugungspfade wie Methanpyrolyse sowie Technologien, die eine erfolgreiche Kopplung und Transformation der entstehenden Energiemärkte und Ener- gieinfrastrukturen erlauben, zum Beispiel Beimischungs- und Entmischungsverfahren für Wasserstoff, Syntheserouten für höherwertige Kohlenwasserstoffe oder Ammoniakcracker.
Die Bundesregierung sollte die gesetzlichen Grundlagen für den Aufbau eines Wasserstoffstartnetzes schaffen. Dieses sollte prioritär durch die Umstellung bestehender Erdgaslei- tungen entstehen, nach Bedarf ergänzt durch einzelne neu gebaute Leitungen. Der Aufbau des Startnetzes ist mit den Planungen der EU und der Nachbarstaaten für eine europäische Wasserstoffinfrastruktur zu koordinieren.
Die Regulierung der neuen Wasserstoffinfrastruktur sollte langfristig entsprechend der gegenwärtigen Regulierung der Erdgasnetze ausgerichtet sein und eine perspektivische Zusammenführung sollte geprüft werden. Auf dem Weg dahin werden regulatorische und marktliche Ansätze benötigt.
Das H2-Startnetz soll unter der Aufsicht der BNetzA für die angestrebte Umstellung von Gasleitungen durch die Ferngasnetzbetreiber umgesetzt und betrieben werden. Hierbei muss zu Beginn die Geschwindigkeit beim Aufbau im Vordergrund stehen. Dies erfordert auch einen nachhaltigen Finanzierungsrahmen.
In diesem Zuge sollte auch ein Konzept für einen fairen Umgang mit den Anschlussrisiken in der Aufbauphase des Startnetzes vorgesehen werden. Mit Umstellung und Stilllegungen verbundene rechtliche Fragen (z. B. die Versorgung von wenigen verbleibenden Abnehmern) sind komplex und sollten daher ebenfalls zeitnah adressiert und erörtert werden.
Im Rahmen unternehmerischer Initiativen sollten weiterhin Dritte die Möglichkeit erhalten, zur Kundenversorgung neue Wasserstoffleitungen aufzubauen. Es sollte darüber hinaus die Möglichkeit geprüft werden, dass über das Startnetz und Umstellungen hinausgehende Erweiterungsinvestitionen z.B. für Randgebiete des Netzes nach dem Ermessen der BNetzA im Rahmen von Ausschreibungsverfahren an Dritte vergeben werden können. Dabei darf die gesamtsystemische Effizienz nicht aus den Augen verloren werden. In den Konzessionen muss die langfristige Integration in das Wasserstoffnetz festgeschrieben werden.
Die Bundesregierung sollte die Bundesnetzagentur beauftragen, aufbauend auf den vorliegenden Konzepten der Fernleitungsnetzbetreiber und in Koordination mit einer ersten vorgezogenen Durchführung des Systementwicklungsplans einen Planungsprozess für das Startnetz zeitnah durchzuführen und in politisch verbindliche Vorgaben zu überführen.
Die Bundesregierung sollte in enger Abstimmung mit den Bundesländern prüfen, wie die Planungs- und Genehmigungsverfahren für Netzinfrastrukturen (aber auch für Erzeu- gungsanlagen, Großspeicher oder industrielle Anlagen) über die bereits in der Vergangenheit ergriffenen Maßnahmen hinaus noch einmal substanziell beschleunigt werden können, um eine ausreichende Synchronisierung des Netzausbaus mit den für die beschleunigte Energiewende nötigen Transformationspfaden im Energie- und in den Nachfragesektoren errei- chen zu können. Dabei wird es erforderlich sein, auch grund- sätzlichere Fragen wie eine Reduzierung von Einspruchs- und Beteiligungsmöglichkeiten zu adressieren sowie den Klimaschutz gegenüber dem Arten- und Umweltschutz neu zu justieren. Auch die Kompetenzverteilung zwischen Bund und Ländern und die Bündelung bei einer zentralen Genehmigungsbehörde sollten in diesem Zuge geprüft werden.
Die Netzbetreiber sollten mit Unterstützung der BNetzA neben dem notwendigen Ausbau der Stromnetze weiterhin die Optionen zur besseren Nutzung der bestehenden Netzkapazitäten zügig vorantreiben: Dazu gehören, soweit noch nicht umgesetzt, unter anderem die Lastflusssteuerung, der witterungsabhängige Freileitungsbetrieb und weitergehende kurative Netzbetriebsführungskonzepte.
Der verzögerte Netzausbau wird zumindest in der Übergangsphase Ende der 2020er und Anfang der 2030er Jahre zu deutlichen Netzengpässen und gegenüber heute umfangreicheren Redispatch-Maßnahmen und Abregelungen von EE-Anlagen führen.
Die Bundesregierung sollte bei der weiteren Ausrichtung des Klimaschutzplans die daraus entstehenden Auswirkungen auf die Treibhausgasbilanz im Energiesektor einkalkulieren und den entstehenden Bedarf an Redispatchvolumen für die weitere Entwicklung der steuerbaren Kraftwerksleistung berücksichtigen.
Die Netzbetreiber sollten mit Unterstützung der BNetzA neben dem notwendigen Ausbau der Stromnetze weiterhin die Optionen zur besseren Nutzung der bestehenden Netzkapazitäten zügig vorantreiben: Dazu gehören, soweit noch nicht umgesetzt, unter anderem die Lastflusssteuerung, der witterungsabhängige Freileitungsbetrieb und weitergehende kurative Netzbetriebsführungskonzepte.
Aufgrund des zukünftigen Bedarfs an klimaneutraler, gesicherter Leistung und der hierfür erforderlichen Neuinvestitionen bedarf es einer Überprüfung der Instrumente zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit. Denn die bestehenden Reservemechanismen können in ihrer gewachsenen Struktur und mit Blick auf die dynamischen Veränderungen durch die Energiewende die Versorgungssicherheit absehbar weder effektiv noch effizient gewährleisten.
Die Bundesregierung sollte daher für die rechtzeitige und ausreichende Sicherstellung gesicherter Leistung prüfen, die bestehenden Reservemechanismen durch ein neues umfassendes Konzept für eine Systemreserve zu ersetzen und zusätzlich durch einen weitreichenderen Kapazitätsmarkt für gesicherte Leistung im Strommarkt zu ergänzen.
Dabei ist mit Blick auf die folgenden Anforderungen zu prüfen, welche Ausgestaltung von Kapazitätsmechanismen kurz- und mittelfristig geeignet ist und ausreichend schnell umgesetzt werden kann:
Auf EU-Ebene sollte zudem die grenzüberschreitende Versorgungssicherheit weiter gestärkt werden. Hierzu ist die länderübergreifende Bewertung und Bereitstellung gesicherter Leistung, wie bereits mit dem Prozess ERAA (European Resource Adequacy Asessement) angestoßen, kontinuierlich weiterzuentwickeln. Im Rahmen von ENTSO E sollten Regeln für supranationale Beistandsmaßnahmen bei Versorgungsengpässen entwickelt werden.
Die Transformation im Energiesektor bringt zum Beispiel durch den zunehmenden Einsatz von Leistungselektronik und die Digitalisierung sukzessive neue Fragen und Herausforderungen bei der Systemsicherheit 22 mit sich. Um diesen Herausforderungen begegnen zu können, sollte die Bundesregierung die im Rahmen des Klimaschutzprogramms 2030 bereits vorgesehene „Gesamtstrategie Systemsicherheit und Netzstabilität, Digitalisierung und IT-Sicherheit der netzgebundenen Stromversorgung“ schnellstmöglich erstellen und Vorschläge für Regulierungsvorgaben ableiten.
Für eine vorausschauende Identifizierung und Adressierung kommender Herausforderungen ist ein kontinuierliches Monitoring der verschiedenen Aspekte der Systemsicherheit zu etablieren, durch das neben dem definierten Fokus (z. B. Momentanreserve) auch neue Herausforderungen in einem digitalisierten Energiesystem identifiziert. Nur so können mit ausreichend Vorlaufzeit geeignete Gegenmaßnahmen eingeleitet werden.
Im Rahmen der Entwicklung der neuen Energiemärkte für klimaneutralen Wasserstoff und weitere gasförmige und flüssige Energieträger und Grundstoffe sollte die Bundesregierung unter Einbindung der Bundesnetzagentur und der beteiligten Stakeholder sowie in Koordination mit den europäischen Nachbarn daher geeignete Strategien für die dauerhafte Versorgungssicherheit entwickeln, aber auch Konzepte, um die besonderen Unsicherheiten in der Aufbauphase zu adressieren und für die beteiligten Akteure ausreichende Sicherheit in der Transformation zu gewährleisten.
Neben Treibhausgas-Minderungen der Verbrauchssektoren sind für Klimaneutralität Maßnahmen in Landwirtschaft, Landnutzung, Landnutzungsänderung und Forstwirtschaft sowie der Aufbau technischer Senken notwendig. Das Klimaschutzgesetz 2021 sieht für Deutschland die Erreichung der Treibhausgasneutralität 2045 sowie eine netto-negative Bilanz nach 2045 vor. Dafür müssen sich 2045 die THG-Senken mit den verbleibenden Emissionen die Waage halten, und diese nach 2045 sogar übertreffen.
Die Bundesregierung sollte einen Prozess anstoßen, um eine integrierte Senkenstrategie zu entwickeln, welche die „Longterm Low Emissions Development Strategies (LT-LEDS) und die „Nationally Determined Contributions“ (NDC) ergänzt und einen glaubhaften Weg zu Netto-Null und Netto-Negativ unter Abwägung technischer und natürlicher Senkenpotenziale aufzeigt. Zudem sollte auch auf europäischer Ebene auf die Entwicklung einer übergeordneten grenzüberschreitenden Strategie hingewirkt werden, die die verschiedenen Rahmenbedingungen der europäischen Länder berücksichtigtund eine grenzüberschreitende Planung ermöglicht.
Eine ehrliche Betrachtung der Notwendigkeit von Senken erfordert auch eine robuste Planung. Die Bundesregierung sollte daher in ihren Energiekonzepten mit den Energiebedarfen für Senken planen sowie eine mögliche Zielverfehlung für LULUCF in das Risikomanagement aufnehmen (siehe Kapitel 1 „Gesamtstrategie“).
Die Bundesregierung sollte sicherstellen, dass die vermeid- baren Treibhausgasemissionen bis 2045 vollständig reduziert werden und gleichzeitig in CCU/S-Technologien investiert wird, um die residualen Emissionen (z. B. aus dem Zement- sektor) abzuscheiden und parallel den Ausbau der technischen CO2-Entnahmetechnologien zu forcieren. Hierfür ist die Ausweisung eines separaten CO2-Entnahmeziels nötig und es
müssen Anreizsysteme für den Hochlauf von Negativemissionstechnologien mit verifizierbarer Entnahme und Permanenz geschaffen werden.
Zunächst sollte über Pilotprogramme und Innovationsförderungen die Technologieentwicklung vorangetrieben werden, bevor auf mittlere Sicht die erreichten Negativemissionen vergütet werden, beispielsweise über Auktionen mit einer Abnahme- und Preisgarantie.
Die Bundesregierung sollte unterstützende Analysen in Auf- trag geben, um passende Instrumente für eine effiziente Unterstützung von technologischen Optionen für Negativemissionen zu finden. Die Bundesregierung sollte sich zudem mittelfristig eine Wissensbasis zu einer möglichen Integration von verschiedenen Negativemissionstechnologien in ein Emissionshandelssystem schaffen.
Eine europäische Strategie und gemeinsame Förderprogramme (etwa über den EU Innovation Fund) würden Pla- nungssicherheit schaffen und Synergien heben. Dies ist insbesondere relevant für die grenzüberschreitende Planung und den Bau von CO2-Infrastrukturen. Die Bundesregierung
sollte für eine europäische Strategie und Planung werben. Fragen der Haftung bei Risiken der CO2-Sequestrierung sind zu klären.
Die Bundesregierung sollte prüfen, in welchem Ausmaß eine CO2-Infrastruktur aufzubauen ist, um das Ziel der Klimaneutralität und den Aufbau eines klimaneutralen Kohlenstoffkreislaufs zu erreichen (z. B. Transportkapazitäten für CCU/S zur Vermeidung von Prozessemissionen). Erste Leitungen werden vermutlich dann geplant, wenn große Punktquellen von anders nicht vermeidbaren CO2-Emissionen vermieden werden sollen. Perspektivisch wird ein Netz an CO2-Pipelines benötigt. Der pipelinegebundene Netzausbau könnte durch die Implementierung eines „CO2-Netzentwicklungsplans“ zu gegebener Zeit koordiniert werden. Dieser sollte auf dem integrierten Systementwicklungsplan aufbauen (siehe Kapitel 2 „Marktdesign“).
Die Bundesregierung sollte prüfen, in welcher Form der Auf- bau einer Infrastruktur für CO2, die sowohl für CCU als auch
für CCS notwendig wird, mit der Planung einer Wasserstoffinfrastruktur verzahnt werden kann.
Zudem sollten raumordnerische Planungskompetenzen des Bundes entsprechende Vorzugskorridore für CO2-Pipeline-Infrastrukturen ermöglichen. Eine erste Annäherung wurde bereits im Vorschlag des Prognos-Gutachtens gemacht.
Die Bundesregierung sollte auf europäischer Ebene auf den Aufbau eines regulatorischen Rahmens für eine grenzüberschreitende CO2-Infrastruktur hinarbeiten und hier etwa die EU Strategy for Energy System Integration ausfüllen.
Die Bundesregierung sollte in der kommenden Legislaturpe- riode umfassende Dialog- und Informationsverfahren starten, um über Aufklärung und ehrliche Kommunikation insbesondere die Akzeptanz für CCS zu erhöhen. Ein „Stakeholder- Dialog CCS“ sollte wichtige gesellschaftliche Gruppen und Multiplikatoren zusammenbringen.
Die Bundesregierung sollte in dieser Kommunikation CCU/S als Option für eine Laufzeitverlängerung fossiler Kraftwerke und Technologien ausschließen. Emissionsvermeidung und CO2-Entnahme müssen daher getrennt betrachtet werden. Außerdem sollte CCU/S deutlich abgegrenzt werden von Methoden des Geoengineerings.
Insgesamt sollte auf einen klimaneutralen Kohlenstoffkreis- lauf hingearbeitet werden, in dem CO2 entweder wiederver- wendet (CCU) oder gespeichert wird (CCS). Die Verwendung von CO2 in Produkten der chemischen Industrie ist nur dann klimaneutral, wenn anfallender Abfall wiederverwertet oder bei der thermischen Verwertung das CO2 erneut abgeschieden wird. Der Weg zur CO2-Kreislaufwirtschaft muss durch
entsprechende Verpflichtungen und Förderungen begleitet werden.
Ein klimaneutraler Kohlenstoffkreislauf sollte in einer Kas- kade darauf abzielen, Mengen zu reduzieren, Produkte wie- derzuverwenden, eine möglichst hohe Recyclingrate zu errei- chen und erst im letzten Schritt in die thermische Verwertung zu gehen. Die thermische Verwertung muss durch den Einsatz von CCU/S CO2 abscheiden und dem Kohlenstoffkreislauf wieder zuführen oder endgültig sequestrieren (siehe auch Kapitel 7 „Industrie“).
Langlebige Produkte mit Kohlenstoffbindung spielen in die- sem Kreislauf eine wichtige Rolle. Für die Verwendung von CO2 in besonders langlebigen Produkten wie Karbonfasern oder als Bestandteil von Zement ist noch viel Forschung und Entwicklung nötig. Die Bundesregierung sollte daher ver- stärkt in Programme zur Erforschung der langfristigen Wiederverwendung und Speicherung von CO2 investieren.
Für die Anrechenbarkeit von CCU in weniger langlebigen Produkten muss die gesamte Prozesskette transparent und nachvollziehbar sein. Hierfür werden Fortschritte bei „Moni- toring, Reporting and Verification“ (MRV) benötigt. Erst dann kann auch CCU als Negativemission angerechnet werden.
Die Bundesregierung sollte auf den gegenwärtigen Trend des Rückgangs der Senkenleistung des LULUCF-Sektors und auf die Zielverschärfungen im KSG mit einem Sofortprogramm zum Schutz und Ausbau natürlicher Senken reagieren.
Die Bundesregierung sollte die Klimawirksamkeit organischer Böden berücksichtigen und mit ambitionierten Moorschutz- und Wiedervernässungsprogrammen auf Bundes- und Länderebene dazu beisteuern, die Emissionen aus der Landnutzung zu reduzieren. Hierfür können auch Instrumente über den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) sowie über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) genannt werden. Die in dieser Legislaturperiode vom Bundesumweltministerium herausgegebene Moorschutzstrategie sollte zu einer Bundesstrategie weiterentwickelt werden, die in der Lage ist, diese Ziele zu erreichen.
Die Bundesregierung sollte kurz- und mittelfristig die Sen- kenleistung über LULUCF oder AFOLU separat zu techni- schen Senken anreizen und regulieren. Wichtig ist zudem der Aufbau einer einheitlichen Zertifizierung und einheitlicher Bilanzierungsregeln, um auch Probleme der Permanenz natürlicher Senken zu adressieren (erst dann könnten natürliche Senken in einen CO2-Preis-basierten Ansatz überführt werden).
Der LULUCF-Bereich ist gekennzeichnet von hoher Unsicherheit über die erreichten Negativemissionen und ihre Permanenz. Die Bundesregierung sollte sich daher dafür einsetzen, das MIV der natürlichen Kohlenstoffsenken zu verbessern. Hier sollten das Verständnis des LULUCF-Sektors und Methoden zur Fernerkundung von Kohlenstoffspeichern gefördert, Methoden zur Bilanzierung verbessert und damit auch Doppelbilanzierungen (z. B. LULUCF und Energiewirtschaft) verhindert werden.
Die Bundesregierung sollte die Unsicherheit bei natürlichen Senken auch berücksichtigen, indem sie den Aufbau von klimaresilienten Wäldern fördert und gleichzeitig zur Erreichung der erforderlichen Negativemissionen keine Abhängigkeit vom LULUCF-Sektor schafft, indem andere Senkenpotenziale vernachlässigt werden. Klimaresiliente Wälder lassen sich über einen gezielten Umbau zu naturnahen Laub- und Mischwäldern unter Einbeziehung von Klimaprognosen schaffen.
Die Bundesregierung sollte zudem verschiedene Ziele im LULUCF-Sektor (Aufbau Senkenleistung im Wald, Holzwirtschaft, Biomassenutzung, Biodiversität) abwägen und eine Strategie erarbeiten, die im Rahmen der übergeordneten Senkenstrategie zum Gesamtziel bestmöglich beiträgt.
Die Bundesregierung sollte Programme zur Kaskadennut- zung insbesondere bei Holzprodukten stärken. Darüber hinaus sollte für Produkte am Ende der Nutzungskaskade (Hygienepapiere, Verpackung) die Verwendung von Primärfasern beendet (auch über ordnungsrechtliche Vorgaben) und das Recycling verpflichtend werden.
Die Bundesregierung sollte eine Biomassenutzungsstrategie erarbeiten, die sowohl die energetische und stoffliche Nut- zung von Biomasse betrachtet als auch die Senkenleistung von Biomasse, um Zielkonflikte beispielsweise hinsichtlich von Flächenverfügbarkeit und Nutzungskonkurrenzen zu untersuchen und zu bewerten.
Dabei sollte herausgearbeitet werden, wo Bioenergie effizient eingesetzt werden kann (z. B. als Hochtemperatur-Prozesswärme in der Industrie). Im Ergebnis sollte eine Abschätzung vorliegen, wie sich das nachhaltig verfügbare Biomassepotenzial auf die Nutzungssektoren aufteilen kann, um die Nutzung von Biomasse weiterhin als zentrale Säule für die kosteneffiziente Defossilisierung zu sichern.
Entscheidend dafür ist die Etablierung eines dauerhaften Monitoringsystems für Biomasse, um die Potenziale sowie die Nutzung von Biomasse zukünftig besser beurteilen zu können. Für den Bereich Bioenergie hat die dena bereits das „Marktmonitoring Bioenergie“ ins Leben gerufen. Zur weiteren Erarbeitung einer Biomassenutzungsstrategie bleibt jedoch ein Stakeholder-Dialog mit den Industrievertretern und politischen Entscheidungsträgern notwendig.
Die gesamte Wertschöpfungskette von der Biomasseerzeugung bis zum Endenergieeinsatz muss zukünftig transparent und nachvollziehbar sein, um eine nachhaltige Bereitstellung für Endanwendungen garantieren zu können. Außerdem sollten Bedingungen für den Import von Biomasse festgesetzt werden, um Verlagerungseffekte wie nicht nachhaltige Biomasseproduktion im Ausland zu vermeiden.
Die Bundesregierung sollte die Rahmenbedingungen schaf- fen, damit die Abscheidungsleistung und Negativemissionspotenziale (über BECCS) in der Industrie genutzt werden können, da in einigen Branchen sowieso Carbon Capture-Anlagen aufgebaut werden müssen, um Restemissionen zu vermeiden. Dies könnte sich in einer zeitnahen Entwicklung von Anreizsystemen für Negativemissionen (siehe oben) äußern und muss in der Biomassenutzungsstrategie reflektiert werden.
Der Einsatz von Biomasse und BECCS in der energieintensiven Industrie ist aufgrund der notwendigen Hochtemperatur- Wärmebedarfe in Teilen eine „No Regret“-Strategie, solange ausreichend nachhaltige Biomasse zur Verfügung steht.
Die Bundesregierung sollte die zentrale Rolle der Landwirt- schaft bei der Transformation anerkennen und neben den notwendigen technischen Maßnahmen Anreize und Möglichkeiten schaffen für eine Veränderung klimaschädlicher Konsummuster auch im Bereich landwirtschaftlicher Produkte. Der Konsum tierischer Produkte ist die zentrale Stellschraube in der Landwirtschaft und bedingt maßgeblich die Emissionen aus der Viehhaltung sowie die Flächenverfügbarkeit für den Anbau energetischer Biomasse oder den Aufbau natürlicher Senkenleistung. Neben Informationskampagnen und Kommunikationsmaßnahmen sollte dies durch höhere Stanards in der Tierhaltung (und damit höhere Preise) und die Förderung von Fleischalternativen angereizt werden. Dabei sind die Wechselwirkungen im europäischen Binnenmarkt für Agrarprodukte zu berücksichtigen und gegebenenfalls entsprechende Initiativen und Anstrengungen auf EU-Ebene zu forcieren.
Die Bundesregierung sollte über die Anforderungen der Gemeinsamen Agrarpolitik hinausgehen und verstärkte Anreize für klimaschützende und biodiversitätserhöhende Maßnahmen in der Landwirtschaft setzen. Die Bundesregie- rung sollte in diesem Rahmen die europäische „Carbon Far- ming Initiative“ unterstützen, die eine neue Einnahmequelle für die Landwirtschaft und Landbesitzer erschließt, welche sich an der Höhe der Klimaschutzwirkung verschiedener Maßnahmen misst, beispielsweise der Erhöhung der Kohlenstoffsenke durch verbesserte Bodenbewirtschaftung.
Die Bundesregierung sollte zudem mit einem bundesweiten Sofortprogramm die Wiedervernässung organischer Böden beschleunigen. Dabei müssen Landwirte für Produktivitätsverluste angemessen entschädigt werden. Klimaschutz darf auch in der Landwirtschaft nicht zu sozialen Spannungen führen.
Die Bundesregierung sollte Maßnahmen ergreifen, um den Kunstdüngereinsatz in der Landwirtschaft zu reduzieren. Dies würde zu niedrigeren Lachgasemissionen und auch einem verringerten Energiebedarf für die Ammoniakherstellung führen (siehe Kapitel 7 „Industrie“). Eine klimafreundliche Alternative könnte die vermehrte Verwendung von Gärresten sein.
Viele der in diesem Kapitel diskutierten Technologien und Handlungsoptionen stehen am Anfang ihrer Entwicklung (technologische Senkenoptionen) oder befinden sich in einem sehr komplexen Gefüge von Wechselwirkungen (beispielsweise natürliche Senken). Die Bundesregierung sollte daher die Forschung und die Wissensbildung in diesen Berei-chen ausweiten und intensivieren.
Die dena-Leitstudie Aufbruch Klimaneutralität bietet eine Basis für fundierte strategische Entscheidungen der politischen und wirtschaftlichen Akteure zur Erreichung von Klimaneutralität 2045. Ein Alleinstellungsmerkmal der dena-Leitstudie ist der Multi-Stakeholder-Ansatz. Wir haben Stimmen von Beteiligten aus Beirat und Wirtschaft, von Gutachtern und der dena gesammelt.
Die dena-Leitstudie Aufbruch Klimaneutralität umfasste zwei Phasen. In Phase 1 wurden ein ambitioniertes Referenzszenario sowie ein Zielszenario zur Treibhausgasneutralität aufgestellt (August 2020 bis Februar 2021). Der im März veröffentlichte Zwischenbericht gewährte einen Blick in die Werkstatt der Leitstudie. Er bildete erste Erkenntnisse und Ableitungen aus den zentralen Handlungsfeldern ab. Im Anschluss an den Zwischenbericht folgten in Phase zwei die Modellierung der Szenarien, die von weiteren Diskussionen in den Arbeitsgruppen begleitet wurden. Im Verlauf der Studie entwickelten die beteiligten Expertinnen und Experten konkrete Umsetzungspfade und Handlungsempfehlungen für Wirtschaft, Politik und Gesellschaft.
Übergeordnet zu den jeweiligen Erkenntnissen in den Sektoren und Querschnittsthemen haben die Projektbeteiligten sieben Impulse identifiziert, die essenziell für eine beschleunigte Transformation sind. Es wird deutlich: Der Weg zur Klimaneutralität ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die nur gemeinsam mit Politik, Wirtschaft und Bürgerinnen und Bürgern gelingen kann.
Ein wesentlicher Teil der Analysen findet in vier Sektormodulen statt: Energiewirtschaft, Gebäude, Industrie und Verkehr. Diskutiert werden jeweils Lösungsansätze zur Erreichung von Klimaneutralität im Jahr 2045 sowie die passenden Parameter zur Quantifizierung der sektorspezifischen Transformationspfade im Rahmen der energiesystemischen Modellierung.
Um integrierte Lösungen zu erarbeiten, diskutieren die projektbeteiligten Expertinnen und Experten in drei Querschnittsmodulen die sektorübergreifenden Inhalte: Energiemarktdesign, Transformation sowie Wirtschaft & Europa.
Das Pariser Klimaabkommen aus dem Jahr 2015 ist ein Meilenstein der internationalen Klimapolitik. 195 Staaten, darunter auch Deutschland, haben sich geeinigt, den globalen Temperaturanstieg auf deutlich unter 2°C gegenüber dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen. Zahlreiche Akteure in Politik und Wirtschaft betrachten die Ziele dieses Abkommens als unumkehrbar und suchen nach Wegen, wie sie am besten zu erreichen sind.
Deutschland hat sich mit dem Klimaschutzgesetz von 2019 erstmals gesetzlich verpflichtet, „Treibhausgasneutralität bis 2050 als langfristiges Ziel zu verfolgen“. Mit der Änderung des Klimaschutzgesetzes im Juni 2021 hat die Bundesregierung die Klimaschutzvorgaben verschärft und das Ziel der Treibhausgasneutralität bis 2045 gesetzt. Bereits bis 2030 sollen die Emissionen um 65 Prozent gegenüber 1990 sinken. Das mit dem Green Deal verkündete EU-Klimaneutralitätsziel für 2050 bettet das deutsche Klimaziel in eine gesamteuropäische Strategie ein.
Das Ziel Klimaneutralität stellt alle Akteure vor eine gewaltige Aufgabe. Sie lässt sich nicht durch Einzelmaßnahmen in einzelnen Sektoren lösen, sondern nur durch ein grundlegendes Neudenken von Wirtschaft und Gesellschaft und eine vollständige Transformation des Energie- und Wirtschaftssystems.
In der dena-Leitstudie Aufbruch Klimaneutralität wurden mit einem breiten Stakeholderkreis aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Zivilgesellschaft mit Nichtregierungs- und Umweltschutzorganisationen mögliche Lösungen und Wege zur Klimaneutralität in Deutschland herausgearbeitet. Die Leitstudie bietet konkrete Umsetzungspfade und Handlungsempfehlungen für die kommende Legislaturperiode und nennt 84 detaillierte Aufgaben für die neue Bundesregierung zur Erreichung der Klimaziele.
Die dena-Leitstudie Aufbruch Klimaneutralität verfolgt wie die erste dena-Leitstudie aus dem Jahr 2018 einen integrierten und diskursorientierten Ansatz. Dieser kombiniert wissenschaftliche Analyse mit den Fach- und Marktexpertisen verschiedener Stakeholdergruppen. Die wissenschaftliche Szenariobildung und Modellierung wurde mit den Akteuren abgeglichen, die skizzierte Pfade und Lösungsansätze in der Realität umsetzen müssen. Das macht die daraus resultierenden Empfehlungen praktikabel und besonders belastbar.
Die politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklungen haben sich seit der ersten dena-Leitstudie Integrierte Energiewende deutlich gewandelt. Klimaneutralität bis zum Jahr 2045 erfordert in allen Bereichen ambitionierte Veränderungen bis zur Umkehr von langjährigen Trends und Verhaltensweisen. Die Anforderungen liegen insgesamt deutlich über dem in der ersten dena-Leitstudie zugrunde gelegten Zielkorridor.
Es gilt nun, die passenden Rahmenbedingungen zu schaffen, um diese Herausforderungen zu bewältigen. Die 202er Jahre sind eine Dekade der Weichenstellungen, um Innovationen und Investitionen zu fördern und den Weg zur Klimaneutralität in Deutschland und in der EU nicht nur zu einer klimapolitischen, sondern gleichzeitig zu einer wirtschaftlichen Erfolgsgeschichte zu machen.
Die dena-Leitstudie Aufbruch Klimaneutralität gibt Wirtschaftsakteuren strategische Orientierung zur Ausrichtung ihrer Geschäftsaktivitäten auf dem Weg in eine klimaneutrale Gesellschaft. Der Politik bietet die Leitstudie zentrale Handlungsempfehlungen für die kommende Legislaturperiode. Sie nennt 84 detaillierte Aufgaben für die neue Bundesregierung zur Erreichung der Klimaziele.
Das Klimaschutzgesetz aus dem Jahr 2019 hat in Deutschland erstmals den Begriff Treibhausgasneutralität im Rahmen eines Gesetzes definiert und als Gleichgewicht zwischen menschengemachten (anthropogenen) Treibhausgasemissionen als Quellen und dem Abbau solcher Treibhausgase (THG) durch Senken beschrieben.
Der Begriff Klimaneutralität weist über die reine Betrachtung von Treibhausgasemissionen hinaus. Er beschreibt den Zustand, in dem sich die Wirkungen sämtlicher anthropogener und natürlicher Faktoren gegenseitig aufheben, sodass sich die globale Durchschnittstemperatur stabilisiert. Zu den relevanten Faktoren gehören neben Treibhausgasemissionen auch Veränderungen der Luftverschmutzung (z. B. durch Ruß, Schwefeldioxid (SO2) oder Feinstaub), der Wolkenbedeckung (Höhe und Art der Wolken) sowie das Rückstrahlvermögen (Albedo) der Erdoberfläche.
Im Rahmen der dena-Leitstudie Aufbruch Klimaneutralität wurde in der Modellierung und der Diskussion von Maßnahmen gemäß der aktuellen Gesetzgebung die größtmögliche Minderung menschengemachter, nationaler THG-Emissionen aus allen Quellen als Ziel gesetzt. Zusätzlich wurde der Abbau verbleibender Emissionen durch technische und natürliche Senken auf „Netto-Null“ analysiert. Neben Kohlenstoffdioxid wurden – so weit möglich – auch die wichtigsten CO2-Äquivalente berücksichtigt, etwa bestimmte Methanquellen im Energie- und Verkehrssektor sowie anthropogene Quellen von Methan und Lachgas in der Landwirtschaft. Bei einer engen Auslegung der Begriffsdefinition betrachtet die dena-Leitstudie also keine Klima-, sondern Treibhausgasneutralität.
Die dena-Leitstudie Aufbruch Klimaneutralität ist wie die vorangegangene Leitstudie ein Multi-Stakeholder-Projekt, an dem sich ein sehr diverser Kreis unterschiedlicher Akteure und Institutionen aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Zivilgesellschaft beteiligte. Die Einbindung vieler Akteure aus der gesamten Breite der Gesellschaft ist der grundlegende Kerngedanke der dena-Leitstudie. Vielfältige Perspektiven, Erfahrungen und Expertisen wurden einbezogen. Pluralität und Praxisorientierung waren wichtige Grundprinzipien.
Der Kreis der Beteiligten wurde im Vergleich zur vorangegangenen Studie nochmals stark erweitert. Mehr als 320 Personen haben insgesamt aktiv an dem Projekt mitgearbeitet. Darunter mehr als 30 Expertinnen und Experten der dena selbst.
Die mehr als 70 Projektpartner trugen dazu bei, dass die Transformationspfade der dena-Leitstudie ein ambitioniertes und gleichzeitig realistisches Bild zeichnen. Projektpartner sind um Unternehmen und Verbände aus den unterschiedlichsten Branchen, von Start-ups über kleine und mittelgroße Betriebe bis hin zu Großunternehmen: Sie brachten ihre fachlich-technische Expertise und ihre Marktkenntnis im Rahmen der Arbeitssitzungen ein, bei der Konsultation und Kommentierung von Dokumenten sowie im Rahmen digitaler Umfragen, Workshops und übergreifender Diskussionsrunden. Dazu wurden ergänzende Interviews mit Expertinnen und Experten aus weiteren Branchen geführt.
Der 45-köpfige Beirat hat das Vorhaben über seine gesamte Laufzeit begleitet. Darin vertreten sind hochrangige Personen aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft. Der Beirat gab wichtige Impulse für den Projektverlauf und kritische Hinweise zur fortwährenden Überprüfung der Erkenntnisse.
Für das Studienprojekt hat die dena zudem mehr als 10 renommierte wissenschaftliche Institute zusammengeführt, die die Sektor- und Querschnittsmodule begleiteten, umfassende Modellierungen und zahlreiche Detailanalysen erstellten. Zum Projektkonsortium der dena-Leitstudie gehören: das Energiewirtschaftliche Institut an der Universität zu Köln (EWI), das Forschungsinstitut für Wärmeschutz (FIW), das Institut für technische Gebäudeausrüstung (ITG) Dresden, die Jacobs University Bremen, das Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie sowie die Stiftung Umweltenergierecht.
Darüber hinaus wurden weitere Fachgutachter für spezifische Fragestellungen über Zusatzgutachten hinzugezogen.
Eine detaillierte Liste der beteiligten Unternehmen und der im Beirat vertretenen Personen und Institutionen ist im Abschlussbericht zur dena-Leitstudie Aufbruch Klimaneutralität enthalten.
Ähnlich wie die dena-Leitstudie Integrierte Energiewende umfasst auch die Leitstudie Aufbruch Klimaneutralität zwei Phasen. Im Fokus von Phase 1 stand die Erarbeitung eines ambitionierten Referenzszenarios sowie eines Zielszenarios, mit dem sich Klimaneutralität erreichen lässt. Die erste Phase wurde mit der Veröffentlichung des Zwischenberichts abgeschlossen. In Phase 2 wurde die Modellierung überarbeitet und angepasst, um die Belastbarkeit der Ergebnisse zu erhöhen und neue Erkenntnisse zu erzielen.
Ein wesentlicher Teil der Arbeit wurde in den vier Sektormodulen geleistet: Sie betrachten die spezifischen Entwicklungen in den Sektoren Energiewirtschaft, Gebäude, Industrie und Verkehr. Die beteiligten Expertinnen und Experten diskutierten zusätzlich gemeinsam sektorenübergreifende Inhalte in drei Querschnittsmodulen: Energiemarktdesign, Transformation sowie Wirtschaft und Europa. In Arbeitsgruppen wurden zudem branchen- und themenspezifische Fragestellungen bearbeitet. Hier waren auch die Projektpartner eingebunden, die ihre spezifische Expertise und ihre praktischen Erfahrungen einbrachten.
Die Diskussionen und Abstimmungen erfolgten in den regelmäßigen Sitzungen der Sektor- und Querschnittsmodule. Die gemeinsame Bearbeitung spezieller Fragestellungen und Themen mit den Gutachtern und den Projektpartnern lief über digitale Diskussionsforen und geteilte Dokumente. Die Bearbeitungen waren für alle Beteiligten transparent. Einzelne Bearbeitungsstände wurden regelmäßig in Arbeitsgruppensitzungen besprochen.
Im Lenkungskreis, einer Art Vollversammlung aller Akteure, wurden übergeordnete Themen besprochen und die Zwischenergebnisse zu einzelnen Modulen vorgestellt. Das Stimmrecht der Projektpartner war im Lenkungskreis verankert: Jedes beteiligte Unternehmen und jede beteiligte Organisation hatte dabei genau eine Stimme.
Die Arbeitsgruppen und der Lenkungskreis wurden bei der Ausarbeitung der Studieninhalte von den wissenschaftlichen Gutachtern begleitet und beraten; gemeinsam mit der dena bildeten sie das Projektkonsortium. Innerhalb des Projektkonsortiums übernahm die dena die Projektleitung.
Der 45-köpfige Beirat mit Vertreterinnen und Vertretern aus Wissenschaft, Zivilgesellschaft und Politik hatte die Aufgabe, die Neutralität und Ausgewogenheit der dena-Leitstudie zu sichern und die Expertise und Anforderungen weiterer Stakeholder-Gruppen einzubeziehen. Der Beirat beriet zu den verschiedenen Fragestellungen, zur Methodik und zu den Ergebnissen der dena-Leitstudie und gab Empfehlungen ab. Er war über die gesamte Studienlaufzeit hinweg aktiv eingebunden.
Die dena-Leitstudie ist ein co-finanziertes Projekt aus Eigenmitteln der dena und Drittmitteln. Die beteiligten Unternehmen und Institutionen (Projektpartner) leisten einen Finanzierungsbeitrag zur Ermöglichung des Studienvorhabens. Die dena trägt rund 30 Prozent der Gesamtkosten. Die weiteren 70 Prozent verteilen sich auf die mehr als 70 Projektpartner. Die beteiligten Projektpartner werden im Zwischenbericht und im Abschlussbericht transparent dargestellt.
Um die Ausgewogenheit des Partnerkreises sicherzustellen und auch kleinen Unternehmen und Start-ups die Beteiligung zu ermöglichen, ist der Finanzierungsbeitrag gestaffelt. Die Finanzierungsbeiträge für die dena-Leitstudie Aufbruch Klimaneutralität betragen 35.000 Euro netto für größere Unternehmen, 20.000 Euro netto für kleine und mittlere Unternehmen (KMUs; Kategorisierung gemäß KMU-Definition der Europäischen Kommission) und 5.000 Euro netto für Startups. Dies entspricht einem jeweiligen Anteil von 0,2 Prozent bis 1,4 Prozent an der Finanzierung der dena-Leitstudie.
Die dena-Leitstudie Integrierte Energiewende aus dem Jahr 2018 hat gezeigt: Eine erfolgreiche Energiewende erfordert ein funktionierendes Zusammenspiel aller beteiligten Akteure, Energieträger und Technologien sowie der zugehörigen Infrastrukturen und Rahmenbedingungen. Der bis dahin oft diskutierte Ansatz einer „all electric society“ würde – so ein Ergebnis – mit erheblichen Mehrkosten einhergehen. Die dena-Leitstudie Integrierte Energiewende zeigte zudem, dass die Erreichung der (damaligen) Klimaziele erhöhte Anstrengungen in allen Sektoren erforderlich macht.
Unter ökonomischen, ökologischen sowie sozialen Aspekten wurde eine Drei-Pfeiler-Strategie für die Integrierte Energiewende als besonders effizient identifiziert: Synthetisch erzeugte erneuerbare Energieträger und Rohstoffe (Powerfuels) ergänzen dabei Energieeffizienz und den Ausbau der direkten Nutzung erneuerbarer Energien. Eine erfolgreiche Energiewende ist in diesem Sinne in vielerlei Hinsicht integriert: Die einzelnen Sektoren wachsen immer stärker zusammen. In allen Bereichen braucht es einen integrierten Blick auf die Wechselwirkungen mit anderen Sektoren, den Abgleich zwischen Infrastrukturen und Märkten, auf zentrale und dezentrale Lösungen sowie auf nationale und internationale Märkte, um das Gesamtsystem für eine erfolgreiche Energiewende optimieren zu können. Das gilt insbesondere für den Infrastrukturbedarf und die mit dessen Aufbau verbundenen Zeithorizonte.
Ein technologieoffener Ansatz ist zudem oberstes Gebot. Insbesondere, weil die Erfahrung zeigt, dass einzelne Ansätze und Lösungen ins Stocken geraten können. Für diese Fälle braucht es alternative Optionen, um die Klimaziele erreichen zu können.
Der Abschlussbericht der dena-Leitstudie Aufbruch Klimaneutralität…
Das zweite in einer Reihe von Kurzgutachten im Rahmen der dena-Leitstudie…
Das Kurzgutachten „Technische CO2-Senken. Techno-ökonomische Analyse…
Wird Deutschland bis zum Jahr 2050 klimaneutral oder nicht doch eher…
